

Digitales Programm
Sa 30.12. Silvesterkonzert
20.00 Uhr Konzerthaus Berlin
19.55 Uhr Zeiss-Großplanetarium
Live-Übertragung aus dem Konzerthaus
So 31.12. Silvesterkonzert
16.00 Uhr Konzerthaus Berlin
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit Schlusschor über Schillers Ode „An die Freude“
Konzert ohne Pause
Besetzung
Karina Canellakis, Dirigentin
Siobhan Stagg, Sopran
Sophie Harmsen, Alt
Andrew Staples, Tenor
Michael Nagy, Bass
Rundfunkchor Berlin
Justus Barleben, Choreinstudierung
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Das Konzert wird live ins Zeiss-Großplanetarium übertragen.
Podcast „Muss es sein?“
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125


Freude?
War denn alles umsonst, was Beethoven vor 200 Jahren den Menschen entgegenschleuderte: „Freude!“ „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt“? Das Band, mit dem er die Menschen zu einen suchte: „Seid umschlungen, Millionen. Diesen Kuß der ganzen Welt“?
Die Angst vor allem Fremden ist die Ursache für Aggressivität und Hass. Wenn das Fremde weniger fremd wäre, ließe sich Angst vielleicht durch Vertrauen ersetzen. Miteinander reden, um einander besser kennen zu lernen, das scheint das Einfache zu sein, das so unendlich schwer zu machen ist. Beethoven hat diese, unsere brandaktuelle Schicksalsfrage des gedeihlichen Zusammenlebens auf der Erde ganz persönlich und leidvoll erfahren: Vom Miteinander-Reden war er seit seinem 40. Lebensjahr bis zu seinem Tode fast völlig ausgeschlossen. Weil er nicht hören konnte, was seine Mitmenschen sagten. Beethoven war vollkommen taub am Ende.
Schlechtes Sehen trenne von den Dingen, Schwerhörigkeit hingegen trenne von den Menschen, notierte Immanuel Kant. Schwerhörigkeit, eine Krankheit, die im doppelten Sinne des Wortes unsichtbar ist: Man kann sie nicht sehen, und der Betroffene macht sich unsichtbar. Beethoven zog sich aus der Welt der Hörenden zurück. Ein existentieller Teil seines Menschseins ging unaufhaltsam verloren. In seinen Briefen und im Heiligenstädter Testament beklagte er die charakteristische soziale Isolation des Schwerhörigen.
Leben als Verbannter
„So bald ich tot bin – …, so bittet ihn [den Arzt Professor J. Adam Schmidt] daß er meine Krankheit beschreibe…. damit wenigstens soviel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde…“, lesen wir im Heiligenstädter Testament, das der 32-Jährige für seine Brüder aufzeichnete. Offensichtlich trug er sich zu jener Zeit massiv mit Suizidgedanken. Wenige Monate vorher, am 29. Juni 1801 hatte er sich seinem Freund, dem Mediziner Dr. Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) erstmals offenbart: „Der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen schlimmen Streich gespielt, nämlich mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden… nur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort… Ich bringe mein Leben elend zu. Seit zwei Jahren meide ich alle Gesellschaften, weils mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub.
Hätte ich irgend ein anderes Fach so gings noch eher, aber in meinem Fach ist es ein schrecklicher Zustand…. Die hohen Töne von Instrumenten und Singstimmen höre ich nicht, wenn ich etwas weit weg bin, auch die Bläser im Orchester nicht. Manchmal auch hör ich den Redner, der leise spricht, wohl, aber die Worte nicht, und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich.“ Beethoven nennt hier alle Symptome der Schwerhörigkeit: Hochtonverlust und Sprachverständlichkeitsverlust, quälende Ohrgeräusche [Tinnitus], Verzerrungen [Recruitment] und Überempfindlichkeit für Schall [Hyperakusis].
Das Ohr ist das empfindlichste und schnellste Sinnesorgan des Menschen. Die große Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs kann man ermessen, wenn man bedenkt, dass der soeben wahrnehmbare Schalldruck im Innenohr lediglich zu Auslenkungen führt, die ungefähr dem Durchmesser eines Wasserstoffatoms entsprechen, also etwa 10-10 m.
Zeitlich können mehr als 1000 hintereinander auftretende Ereignisse pro Sekunde aufgelöst werden. Vom Trommelfell wird das Schallsignal durch Schwingungen der Mittelohrknöchelchen auf den Steigbügel und von dort durch Ein- und Auswärtsbewegungen seiner Fußplatte auf das Innenohr übertragen.


Die Behandlung von Beethovens Ohrenleiden begann im Jahr 1800. Mandelöl-Ohrentropfen und Meerrettich-Baumwolle wurden angewandt, danach bestimmte Teesorten, aber auch sogenannte Vesikatorien, die zu Blasen auf der Haut führten; man hoffte, dass mit dem Verschwinden der Blasen die Krankheit vergehe. Schließlich wurden dem Patienten lauwarme Donaubäder verschrieben. Man kann sich vorstellen, dass der Heilungserfolg ausbleiben musste. Was heute fremd anmutet, war typisch für die damalige Zeit.
Keine Aussicht auf Heilung
Beethoven wechselte die Ärzte wie die Wohnungen und Haushälterinnen: zeitweise nahezu wöchentlich. Kein Arzt seiner Zeit konnte ihm wirklich helfen. Eine Idee von Johann Mälzel, dem Erfinder des Metronoms, brachte 1814 vorübergehend eine geringe Linderung der Kommunikationsprobleme: ein trichterförmiges Hörrohr. Bald jedoch trat eine dramatische Verschlimmerung von Beethovens Zustand ein. Keiner sollte es merken, und alle waren peinlich berührt, ihn nicht merken zu lassen, dass sie es dennoch bemerkten. 1814 musizierte er zum letzten Mal öffentlich als Pianist.
Danach spielte er nur noch selten im Bekanntenkreis. Um beim Klavierspielen wenigstens die Schwingungen wahrzunehmen, saß der Komponist mit einem Holzstab zwischen den Zähnen am Instrument. Später komponierte er am Klavier, hieb auf die Tasten, ohne dass Saiten darin gespannt waren. Eine gespenstische Vorstellung für ein kreatives Genie wie Beethoven.
1815 beobachtete der Berliner Verleger Simrock, wenn überhaupt noch ein Restverstehen vorhanden sei, dann nur auf dem linken Ohr. Von seiner rechten Seite angesprochen, verstehe Beethoven nichts mehr. 1816, so Simrock, sei Persönliches nur noch per Zettel vermittelbar gewesen. Seit 1818 mussten Gespräche ausschließlich schriftlich geführt werden. Überliefert sind rund 400 sogenannte Konversationshefte, die zwar die Fragen der Gesprächspartner wiedergeben, nicht aber Beethovens Antworten, es sei denn man kann sie aus den einseitigen Notizen erraten.
Vergleicht man Beethovens Porträts aus den Jahren 1812, 1815 und 1818, so gewinnt man den Eindruck, sein Antlitz sei in diesen sechs Jahren um 20 Jahre gealtert. Es spiegelt die furchtbare persönliche Erfahrung.
Doch es kam noch härter. 1819 schrieb der schwedische Dichter Atterbom, Beethoven sei, was man „stocktaub“ nenne. Ludwig Spohr beobachtete 1821, dass Beethoven auf dem Klavier die Tasten nicht mehr anschlug.
Letzter Auftritt
Am 7. Mai 1824 schließlich überredete man den tauben, menschenscheuen, weltberühmten, finanziell bedrängten Beethoven, noch einmal als Dirigent ein Konzert mit eigenen Werken zu leiten.


Von der Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“ über eine Teilaufführung der Missa solemnis bis hin zur Sinfonie Nr. 9 kam ein umfangreiches Programm ausschließlich von Uraufführungen zum Klingen.
Beethoven fungierte zwar formal als Dirigent, tatsächlich folgte das Orchester aber dem Kapellmeister Michael Umlauf, der aus einer Ecke heraus „ko-dirigierte“. Bereits nach dem Kyrie aus der Missa solemnis gab es frenetischen Beifall.
Beethoven wandte sich nicht dem applaudierenden Publikum zu. Er hörte nichts von den Ovationen. Erst als ihn eine der Sängerinnen bei den Schultern nahm und ihn sanft umdrehte, sah er, wie der Saal tobte. Nun war es öffentlich. Nun, in den letzten Jahren seines Lebens gab es wenigstens nichts mehr zu verstecken – was die Kommunikation nicht etwa vereinfachte. Erst auf dem Totenbett erlebte Beethoven noch einmal die soziale Zuwendung, von der er sich mehr als 15 Jahre ausgeschlossen hatte.
Unerhörte Musik
Vorhang auf. Das Welttheater beginnt. In die Tiefe stürzende leere Quinten und Quarten.
Die ersten Töne schon umreißen die Außergewöhnlichkeit des Anliegens. Abgerissen, rezitativisch rufen wütende Akkorde nach äußerster Aufmerksamkeit. Was für ein Rumoren! Unversöhnliches Ringen gegensätzlicher Themen.


Zuspitzung, Aufeinanderprallen, unüberbrückbare Gegensätze. Nur ein trotziger Beethoven ist ein echter Beethoven. Entwicklung innerhalb des Kampfes, nicht über ihn hinaus. Die Sinfonia eroica und die Schicksals-Sinfonie ziehen vorüber. Coriolan ballt die Faust. Stolzes Beharren. Sieg des unbeugsamen Willens. Trümmer. Härte. Kälte. Ratlosigkeit.
Und danach? Ein stampfendes Scherzo. Seine stürmische Lustigkeit donnert: „Los, amüsiert Euch!“ Aus den in die Tiefe stürzenden Quinten sind inzwischen Oktaven geworden. Wie ein Perpetuum mobile, unermüdlich in seinem gestreckten Galopp, vorangetrieben von den allgegenwärtigen Pauken, bietet auch diese Variante keine Lösung des Dilemmas. Endlich ein erster zaghafter Versuch, doch der melodiöse Gegenentwurf im Mittelteil des Scherzos, dem Trio, erhält noch keine Chance. Brüsk wird er abgeschmettert vom Galopp der ewig Eiligen.
So fährt auch dieser Satz mit der düsteren Unerbittlichkeit des Anfangs gegen die Wand.
Es folgt, was vielen Musikfreunden die eigentliche Perle der Neunten ist und was zu einem guten Teil – uneingestanden – das Rezeptionsgeheimnis der ganzen Sinfonie ausmachen mag: das Adagio. Unendlich zart, verzeihend bis auf den Grund der Seele für alle erwiesene Rücksichtslosigkeit, für alle notorische Undankbarkeit, streicht der verbitterte, mürrische Beethoven mit seiner rauhen Hand der Menschheit über den Kopf. Wieder sind es fallende Quarten und Quinten, aber diesmal lösen sie eine überirdisch schöne Melodie aus. So grundsätzlich verändert in ihrem Charakter erscheinen sie, dass wir an uns die Wirkung eines der seltenen direkt zu begreifenden Beispiele dafür wahrnehmen können, was mit uns geschieht, wenn wir einer scheinbar bekannten Figur begegnen, der der Schöpfer Geist eingehaucht, die er zum Leben erweckt hat. Vielleicht eindrucksvoller noch als in der kurz vorher komponierten Missa solemnis manifestiert sich in diesem dritten Satz der Neunten Sinfonie Beethovens nichtkonfessionelle Religiosität. Sie ist geprägt von einem geradezu zwingenden Ethos, von unüberbietbarer moralischer Reinheit, von einem alternativlos festen Glauben an die Menschheit, an niemanden sonst.
Solche Festigkeit des Glaubens hat immer auch etwas Appellierendes, etwas Aktivierendes wider den Zweifel. Beethoven ist weit davon entfernt, einen existierenden Idealzustand zu beschreiben; er beschwört einen zukünftigen. Störendes Blech fährt jäh dazwischen. Gewaltlos fragen die beseelten Figuren nach dem Warum und vermögen ihre idyllische Vision letztlich zu bewahren. Doch ungefährdet auf Dauer sind sie nicht.
Schreckensfanfare und Freudentaumel


Was vermag nun das Finale? Vermag es das Chaos mit der Vision zu verklammern, rhetorisch deutlich zusammenzufassen, zu überhöhen, vielleicht weiterzudenken? Zunächst zieht Beethoven kopfschüttelnd Bilanz. Einer „Schreckensfanfare“ (Richard Wagner), die das Finale eröffnet, folgen Zitate aus den vorangegangenen Sätzen. Nichts ist gewonnen, alles noch beim alten. Dramaturgisch aufs äußerste zugespitzt, konzentriert sich alle Hoffnung auf die schüchterne Melodie, die da leise und schlicht von den Kontrabässen und den Violoncelli, quasi aus dem „Keller“ des Orchesters angestimmt wird.
Noch einmal unterbricht die Schreckensfanfare die aufblühende Vision. Dann greift – unerhört bis dato in einer Sinfonie – die menschliche Stimme ein: „O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere!“ Nun erst gibt es kein Halten mehr für die berühmte Freudenmelodie. Es ist jene Musik, die Beethoven bereits seit mehr als dreißig Jahren durch den Kopf ging, für die er bis dahin noch nicht das geeignete Medium gefunden hatte. Schillers Ode scheint nun Mittel zum Zweck. Die Musik ist keine Vertonung im Sinne von Textausdeutung, sondern bezieht die Worte in ihre Botschaft mit ein. An seiner berühmten Freudenmelodie hat Beethoven jahrelang auf Skizzenblättern gefeilt, sie ist so etwas wie sein persönlicher Gral, sein Allerheiligstes, das hat die Biographik inzwischen herausgefunden. Hier nun, in der Sinfonie Nr. 9, entfaltet er sie, machtvoll, allumfassend – so auftrumpfend, dass das Scheitern ihres Anspruchs bereits mit einkomponiert scheint. Auch Beethoven kann nicht mehr tun, als die Menschen um Verständigung zu bitten, sie ermahnen, ihnen die bevorstehende Freude im Fall der friedlichen Verständigung miteinander ausmalen. Verstehen wir den freudigen Jubel der Sinfonie immer wieder als verpflichtenden Aufruf zu Toleranz, Solidarität und Frieden!
Texte © Steffen Georgi
Rezitativ


O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
und freudenvollere!
Freude!
Rezitativtext von Ludwig van Beethoven
An die Freude
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen!
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.
Friedrich Schiller, Ode „An die Freude“
(Ausschnitt, der von Beethoven in der Sinfonie Nr. 9 vertont wurde)
Kurzbiographien
Karina Canellakis

Karina Canellakis, die für ihre emotionsgeladenen Aufführungen, ihre technische Beherrschung und ihre interpretatorische Tiefe international gefeiert wird, ist eine der gefragtesten Dirigentinnen ihrer Generation. Sie ist Chefdirigentin des Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Erste Gastdirigentin des London Philharmonic Orchestra. Bis zum Ende der Saison 2022/2023 war sie zudem Erste Gastdirigentin des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB).
Vielen in der Welt der klassischen Musik bereits durch ihr virtuoses Geigenspiel bekannt, wurde Karina zunächst von Sir Simon Rattle ermutigt, sich dem Dirigieren zu widmen, während sie zwei Jahre lang als Mitglied der Orchester-Akademie regelmäßig in den Berliner Philharmonikern spielte. Sie trat viele Jahre lang als Solistin, Gastdirigentin und Kammermusikerin auf und verbrachte ihre Sommer beim Marlboro Music Festival, bis das Dirigieren schließlich zu ihrem Schwerpunkt wurde. Karina wurde in New York City geboren und wuchs dort auf.
Seit dem Gewinn des Sir Georg Solti Conducting Award im Jahr 2016 gastiert Karina bei führenden Orchestern auf der ganzen Welt, darunter das Boston Symphony, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony, Philadelphia Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Gewandhausorchester Leipzig, NDR Elbphilharmonie Orchester, Orchestre de Paris, London Symphony Orchestra, LA Phil, San Francisco Symphony, Wiener Symphoniker und Münchner Philharmoniker. Sie war die erste Frau, die 2019 die First Night of the BBC Proms in London mit dem BBC Symphony Orchestra dirigierte. Sie war auch die erste Frau, die 2018 das Nobelpreiskonzert mit der Königlichen Philharmonie Stockholm dirigierte.
Siobhan Stagg

Die Sopranistin Siobhan Stagg ist eine der herausragendsten Künstlerinnen, die in den letzten Jahren aus Australien hervorgegangen sind. Christa Ludwig hat Siobhans Stimme als "eine der schönsten, die ich je gehört habe" beschrieben.
Als Absolventin der University of Melbourne begann Siobhan ihre Karriere als junge Künstlerin bei den Salzburger Festspielen (2013) und an der Deutschen Oper Berlin (2013 - 2015). Als sich ihr Talent herumsprach, wurde Siobhan schnell für wichtige Debüts engagiert, unter anderem an der Hamburgischen Staatsoper, den Berliner Philharmonikern, der Bayerischen Staatsoper, dem Grand Théâtre de Genève, der Niederländischen Nationaloper (Amsterdam), den BBC Proms und dem Royal Opera House Covent Garden in London.
Sophie Harmsen

Sophie Harmsen reiste schon früh viel, da ihre Eltern deutsche Diplomaten waren, und setzt dies in ihrer beruflichen Laufbahn als international erfolgreiche und gefeierte Mezzosopranistin fort. Konzerte und Opernproduktionen haben es ihr ermöglicht, einige der schönsten Konzertsäle und Opernhäuser der Welt zu erleben wie dem Teatro Colon in Buenos Aires, dem Teatro Real in Madrid, dem Palau de la Musica in Barcelona, der Wigmore Hall in London, dem Concertgebouw Amsterdam, dem Konzerthaus Wien, der Philharmonie de Paris, dem Shanghai Grand Theatre und der Elbphilharmonie Hamburg.
In dieser Saison freut sie sich auf ihr Debüt als Octavian im Rosenkavalier in der Felsenreitschule in Salzburg, eine Rückkehr an die Hamburgische Staatsoper und das Ballett John Neumeier für Bachs h-Moll-Messe, eine Tournee durch Bachs Weihnachtsoratorium mit Christophe Rousset und ihr erstes Verdi-Requiem mit Antwerpen Symphony Orchestra und Philippe Herreweghe, Mahlers „Das klagende Lied“ beim Mahler Festival Leipzig mit dem Gewandhausorchester und Dennis Russel Davies und Mendelssohns Walpurgisnacht mit dem SWR Synfonieorchester unter Pablo Heras-Casado. Sophie Harmsen studierte an der Universität Kapstadt und bei Prof. Dr. Edith Wiens, wird seit vielen Jahren von Tobias Truniger betreut und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin.
Andrew Staples

Als produktiver Konzertkünstler trat Andrew mit den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter Sir Simon Rattle auf; das Orchestre de Paris, das Swedish Radio Symphony Orchestra und das London Symphony Orchestra mit Daniel Harding; das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und das ScottishChamber Orchestra mit Robin Ticciati; das Rotterdams Philharmonisch Orkest, das Orcherstre Métropolitain und das Philadelphia Orchestra mit Yannick Nézet-Séguin; die Accademia Santa Cecilia mit Semyon Bychkov; und der Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenboim.
Zu seinen jüngsten und zukünftigen Engagements zählen sein Debüt an der Metropolitan Opera als Andres Wozzeck, Nicias in konzertanten Aufführungen von Thais mit dem Toronto Symphony Orchestra und Das Lied von der Erde mit dem New York Philharmonic, dem Orchestre de Paris, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und dem Budapest Festival Orchestra. Weitere zukünftige Engagements umfassen Rückkehr zum Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und zum Bayerischen Rundfunk München.
Michael Nagy

Der in Stuttgart geborene Bariton mit ungarischen Wurzeln begann seine musikalische Laufbahn bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und studierte Gesang, Liedgestaltung und Dirigieren bei Rudolf Piernay, Irwin Gage und Klaus Arp in Mannheim und Saarbrücken. In Meisterkursen erhielt er wichtige Impulse durch Charles Spencer, Cornelius Reid und Rudolf Piernay, der ihn bis heute gesangstechnisch begleitet.
Im Konzertbereich mischt sich altbewährtes Repertoire, u.a. Brahms-Requiem in Neumarkt unter Thomas Hengelbrock und auf Tournee in Spanien, Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen mit den Bamberger Symphonikern unter dem Chefdirigenten Jakob Hrusa, Mendelssohns Elias mit dem Chorwerk Ruhr bei der Ruhrtriennale oder das Requiem von Gabriel Fauré unter Risto Joos in Groningen mit der Uraufführung von Sciarrions Piogge diverse in Dresden, der Uraufführung von Héctor Parras Wanderwelle unter Leitung von Andris Poga beim WDR Sinfonieorchester in Köln oder der Aufführung des unbekannten Oratoriums Weissagung und Erfüllung unter der Leitung von Duncan Ward beim Symphonieorchester Basel.
Eine zentrale Konzertform sind daneben Liederabende für den Künstler. Mit ausgesuchtem Repertoire tritt er u.a. in Kopenhagen gemeinsam mit Gerold Huber und Malcolm Martineau auf (Schuberts Winterreise und Brahms’ Liebesliederwalzer).
Rundfunkchor Berlin

Mit rund 60 Konzerten jährlich, CD-Einspielungen und internationalen Gastspielen zählt der Rundfunkchor Berlin zu den herausragenden Chören der Welt. Allein drei Grammy Awards stehen für die Qualität seiner Aufnahmen. Sein breit gefächertes Repertoire, ein flexibles, reich nuanciertes Klangbild, makellose Präzision und packende Ansprache machen den Profichor zum Partner bedeutender Orchester und Dirigenten, darunter Kirill Petrenko, Daniel Barenboim, Simon Rattle oder Yannick Nézet-Séguin. In Berlin besteht eine intensive Zusammenarbeit mit den Berliner Philharmonikern sowie mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und ihren Chefdirigenten.
Internationales Aufsehen erregt der Rundfunkchor Berlin auch mit seinen interdisziplinären Projekten, die das klassische Konzertformat aufbrechen und Chormusik neu erlebbar machen. Zum Meilenstein wurde die szenische Umsetzung des Brahms-Requiems als »human requiem« durch Jochen Sandig und ein Team von Sasha Waltz & Guests. Nach Gastspielen u.a. in New York, Hongkong, Paris und Adelaide reist die Produktion im Sommer 2019 erstmals nach Istanbul. Für das Projekt »LUTHER dancing with the gods« reflektierte der Chor im Herbst 2017 in einer genresprengenden Konzertperformance mit Robert Wilson und Musik von Bach, Nystedt und Reich Luthers Wirkung auf die Künste und in den Künsten. Für »TIME TRAVELLERS« wird der Chor in der Spielzeit 2019/20 das Berliner Radialsystem in einen begehbaren Zeittunnel verwandeln. Auf Grundlage von Jonathan Doves Komposition »The Passing of the Year« entsteht mit Filmen, Bildern, Performance und Musik ein interaktives Chorerlebnis.


RSB-Abendbesetzung
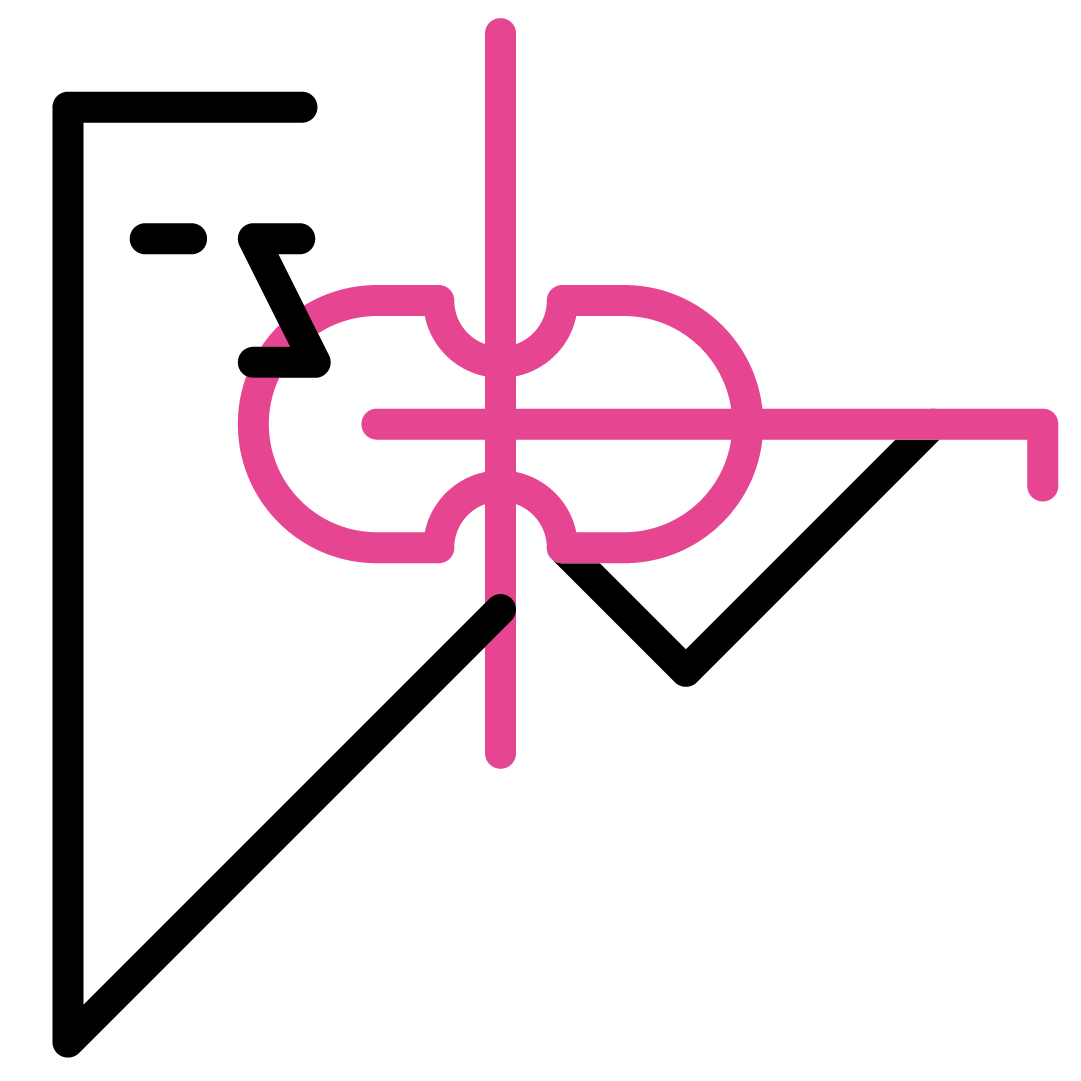
Violine 1
Wolters, Rainer
Nebel, David
Yoshikawa, Kosuke
Neufeld, Andreas
Beckert, Philipp
Kynast, Karin
Tast, Steffen
Pflüger, Maria
Polle, Richard
Oleseiuk, Oleksandr
Scilla, Giulia
Sak, Muge
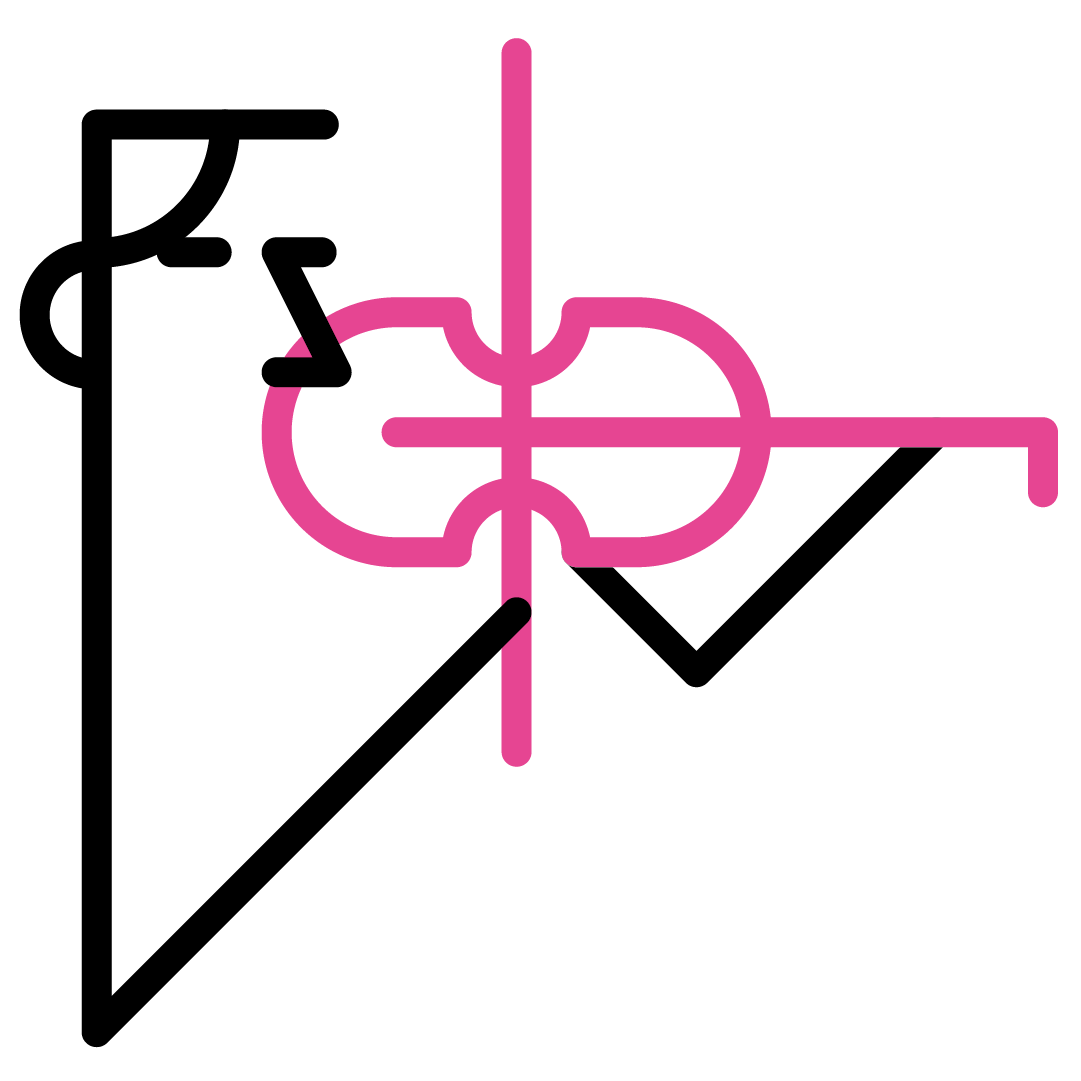
Violine 2
Contini, Nadine
Simon, Maximilian
Seidel, Anne-Kathrin
Buczkowski, Maciej
Manyak, Juliane
Bauza, Rodrigo
Bara, Anna
Palascino, Enrico
Leung, Jonathan
Kanayama, Ellie

Viola
Regueira-Caumel, Alejandro
Silber, Christiane
Zolotova, Elizaveta
Doubovikov, Alexey
Inoue, Yugo
Yoo, Hyelim
Moon, Inha
Yu, Yue

Violoncello
Eschenburg, Hans-Jakob
Riemke, Ringela
Breuninger, Jörg
Weiche, Volkmar
Boge, Georg
Fijiwara, Hideaki
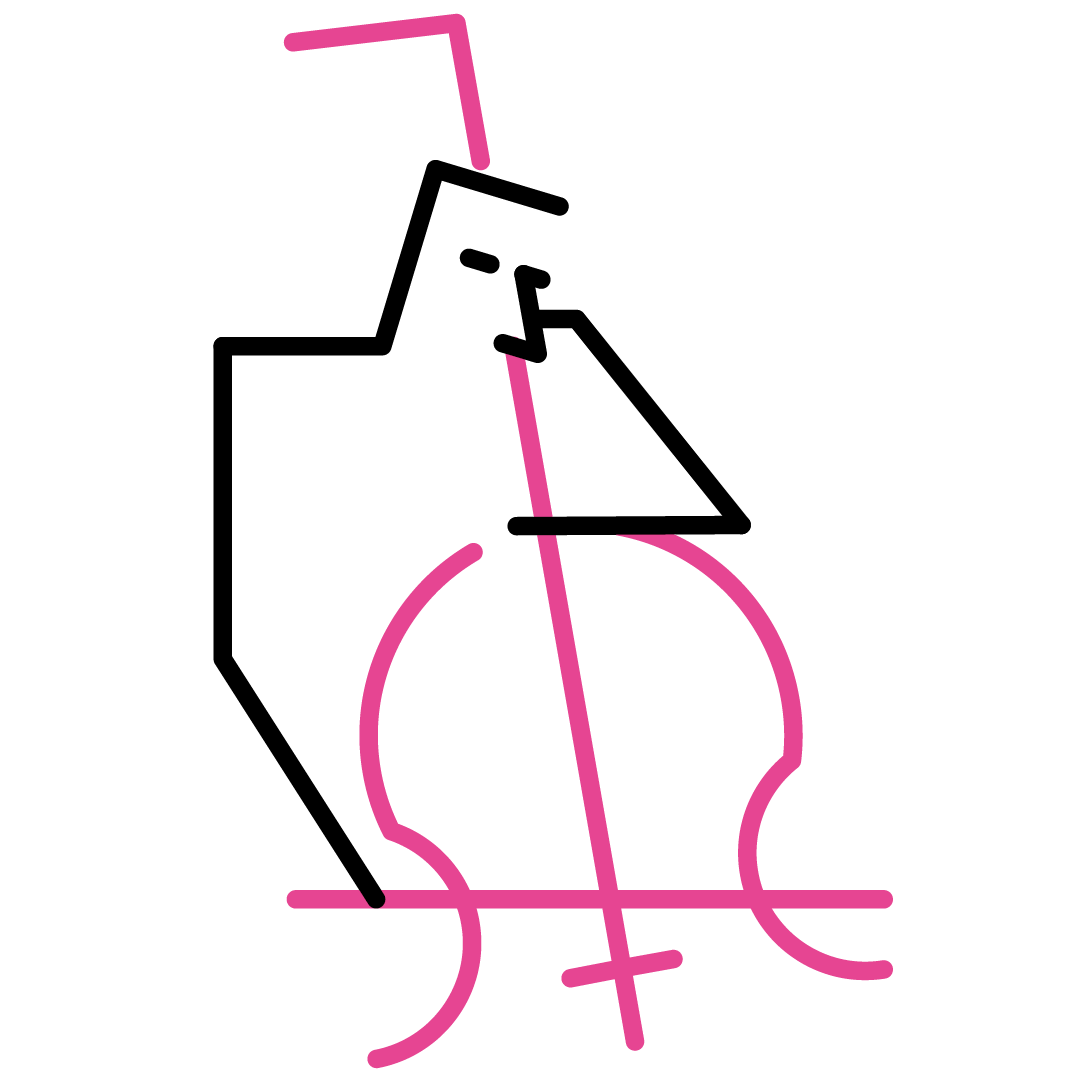
Kontrabass
Wagner, Marvin
Figueiredo, Pedro
Buschmann, Axel
Ahrens, Iris
Thüer, Milan
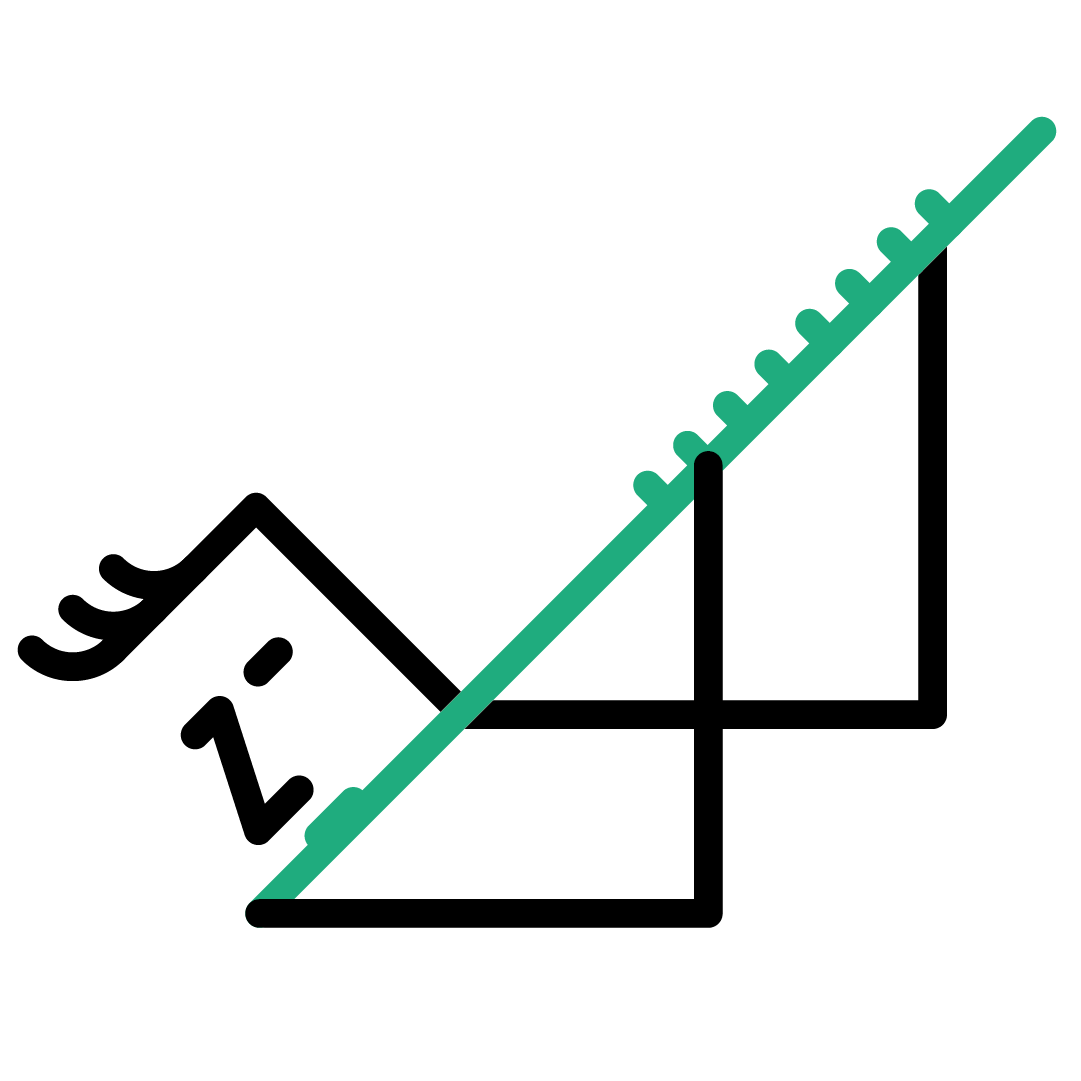
Flöte
Schaaff, Ulf-Dieter
Döbler, Rudolf
Schreiter, Markus
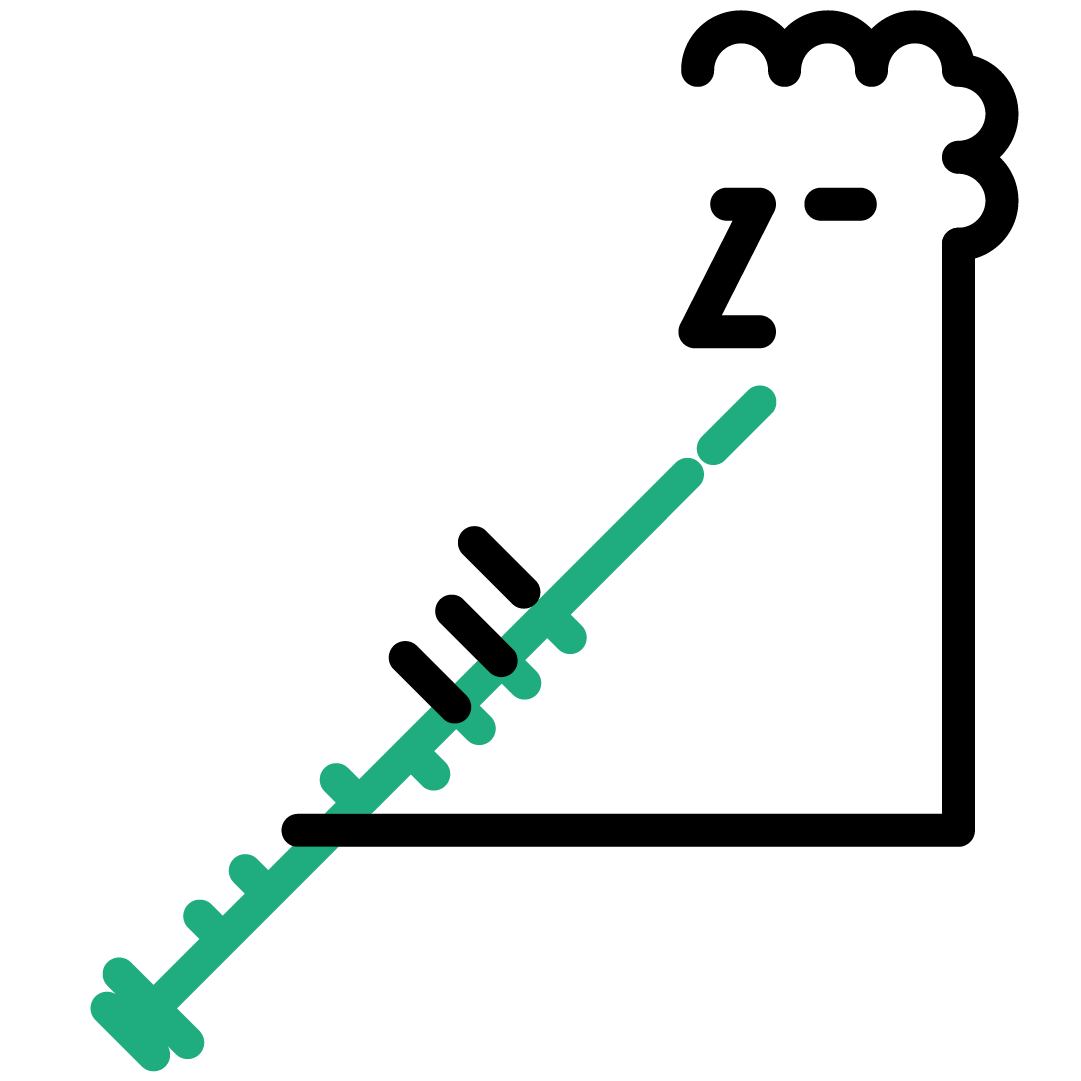
Oboe
Vogler, Max
Grube, Florian
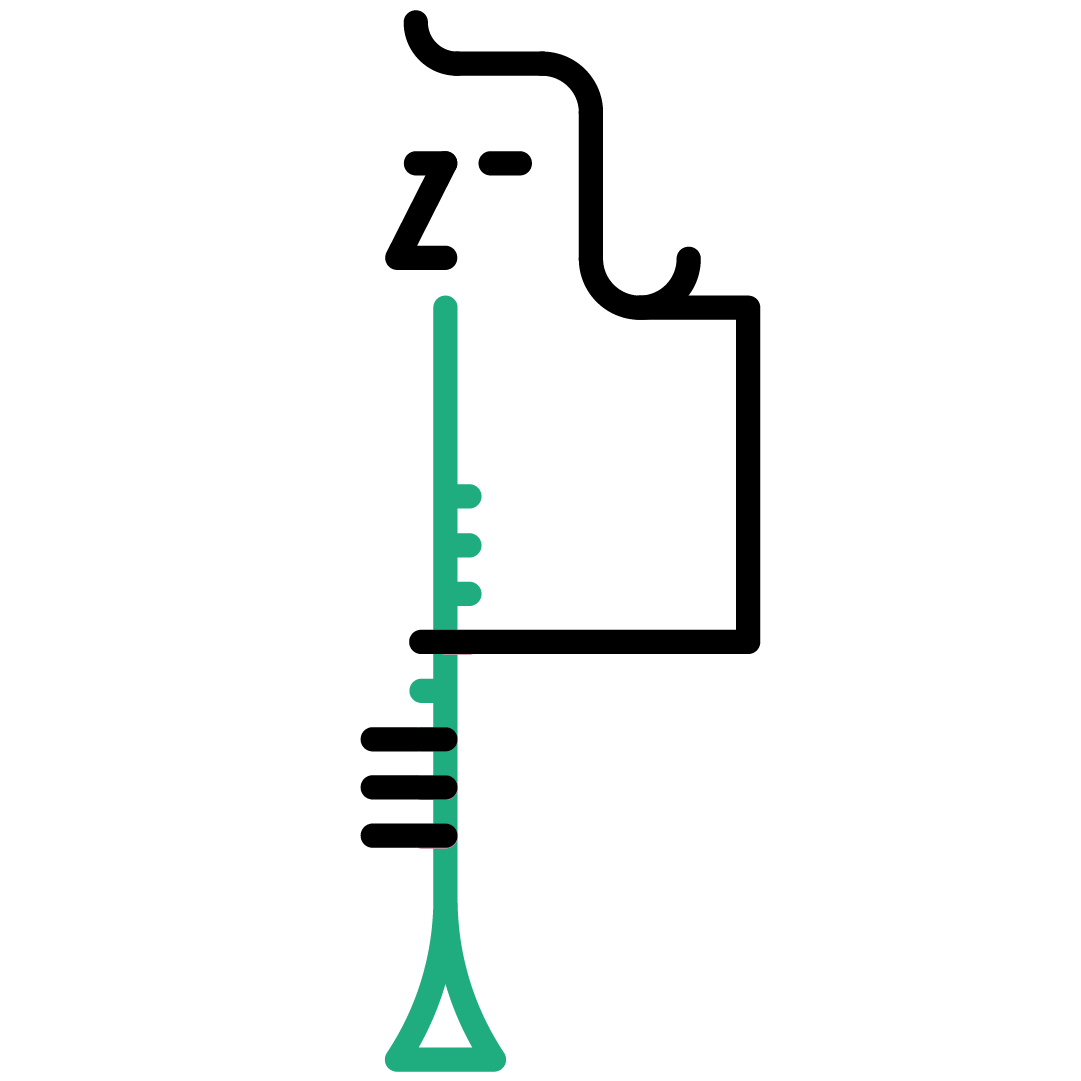
Klarinette
Link, Oliver
Korn, Christoph
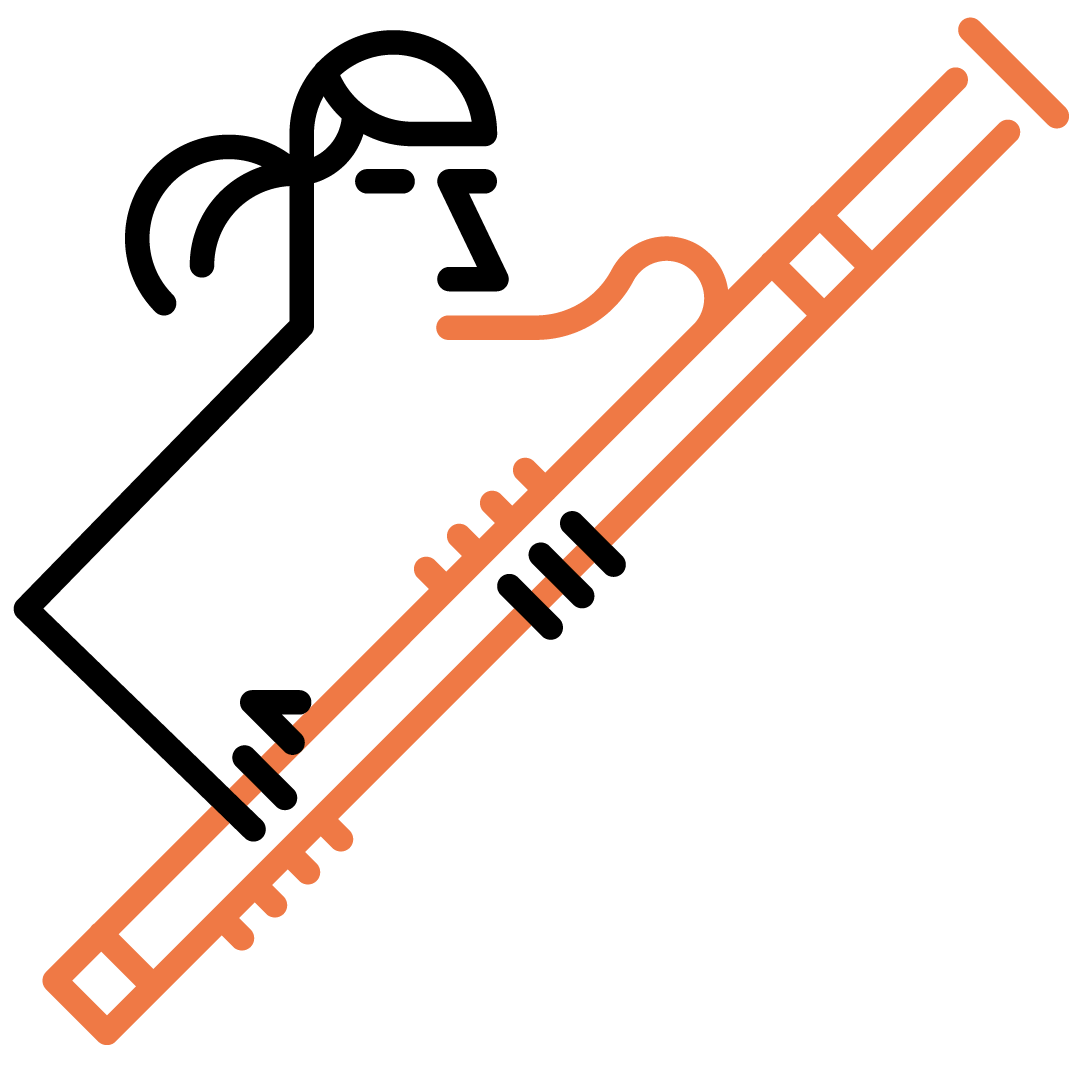
Fagott
Kofler, Miriam
Voigt, Alexander
Königstedt, Clemens

Horn
Kühner, Martin
Klinkhammer, Ingo
Mentzen, Anne
Stephan, Frank

Trompete
Linke, Sören
Gruppe, Simone

Posaune
Manyak, Edgar
Vörös, József
Hauer, Dominik

Schlagzeug
Tackmann, Frank
Thiersch, Konstantin
Westermann, Jan
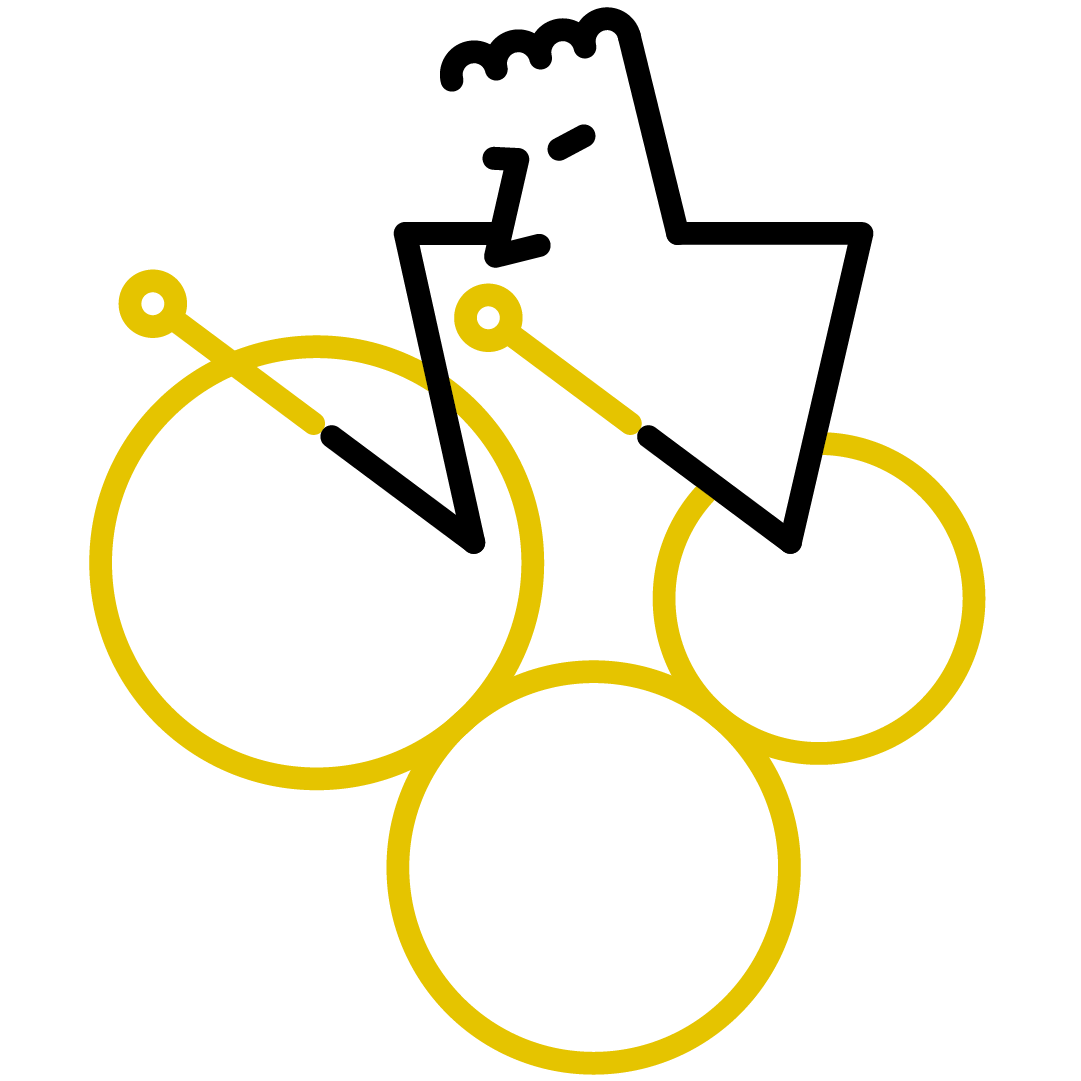
Pauke
Wahlich, Arndt
Kooperation



Bildrechte
Portrait Karina Canellakis © Mathias Bothor
Portrait Siobhan Stagg © © Simon Pauly
Portrait Sophie Harmsen © Tatjana Dachsel
Portrait Andrew Staples © TezArts
Portraits Michael Nagy © Gisela Schenker
Rundfunkchor Berlin © Jonas Holthaus
Bilder Orchester © Peter Meisel