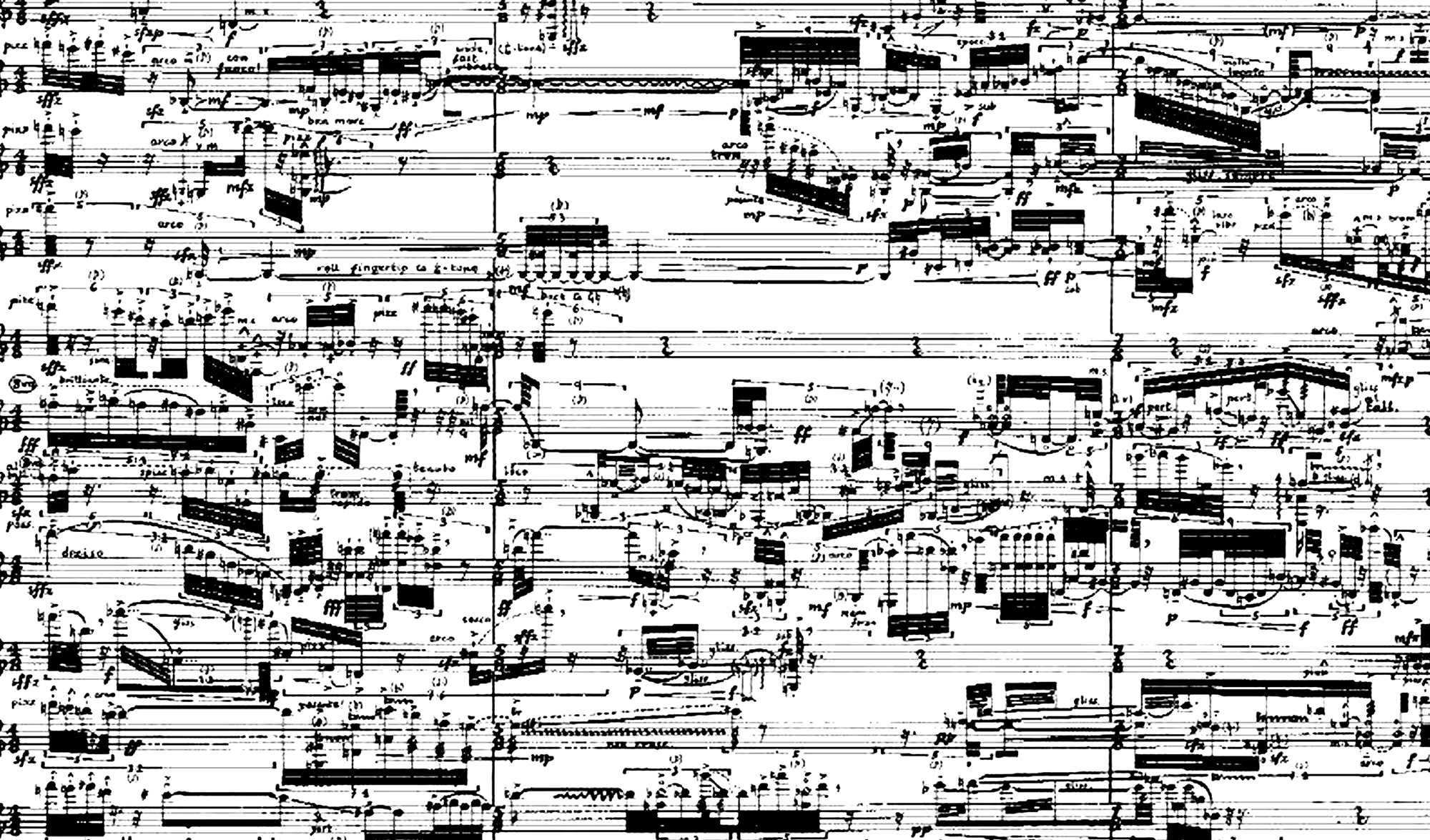Digitales Programm
Sa 27.05. Lahav Shani
20:00 Konzerthaus
György Ligeti
„Atmosphères“
Aaron Copland
Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier
Pause
Sergei Prokofjew
„Romeo und Julia“ – Szenen aus dem Ballett op. 64
Besetzung
Lahav Shani, Dirigent
Martin Fröst, Klarinette
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
19.10 Uhr, Ludwig-van-Beethoven-Saal, Konzerteinführung von Steffen Georgi
Konzert mit Deutschlandfunk Kultur, Radioübertragung am 11.06. um 20:03 Uhr
Die Rundfunkübertragung des Auftritts von Martin Fröst erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Sony Classical, einem Label der Sony Music Entertainment.
Kennen Sie Stanley Kubricks Kultfilm „2001: Odyssee im Weltraum“? Falls ja, erkennen Sie das erste Stück dieses Konzertabends – György Ligetis „Atmosphères“ – bestimmt wieder. Zu hören sind außerdem romantische Szenen aus Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ und Aaron Coplands Klarinettenkonzert mit seinem spezifischen, jazzig-amerkianischen Sound.
Texte von © Steffen Georgi
Podcast „Muss es sein?“
György Ligeti
„Atmosphères“


Die Uraufführung der „Atmosphères“ von György Ligeti am 22. Oktober 1961 war eine Sensation.
Selten sind die Farben eindeutig und die Wolkenform selbst verändert sich ständig und auch die Tempi, mit denen sich die Wolken in- oder gegeneinander bewegen. Etwa in der Mitte des Stückes gibt es eine ganz deutliche Kontrastbildung, wenn die Querflöten eine kleine Tonwolke immer weiter in der Tonhöhe nach oben schrauben oder schieben, lauter und lauter werden und dann von einer tiefen Tonwolke der Kontrabässe abgelöst werden.“ (Hufner)


Stanley Kubrick hat Ligetis „Atmosphères“ in seinem Science-Fiction-Film „2001 – A Space Odyssey“ verwendet.
Auch wenn der Komponist davon zunächst keine Kenntnis hatte, freute er sich 2001 in einem Interview: „Als ich dieses Stück komponierte, habe ich nicht an kosmische Dinge gedacht. ,Atmosphères‘ meint nur die Luft. Meine Musik – in Kubricks Auswahl – passt ideal zu diesen Weltraum- und Geschwindigkeitsfantasien.“
Wissenschaftler und Komponist


Das Miterleben von klanglichen Grenzregionen kann gerade auf den mit solchen Dingen unerfahrenen Hörer eine ungeheuer suggestive Spannung ausüben. Das weiß Ligeti und er spielt damit. Aber er ist kein wilder Provokateur.
1923 in Siebenbürgen geboren, komponiert György Ligeti schon im Alter von 14 Jahren erste Klavierstücke. Nach dem Abitur 1941 will er ursprünglich Physik studieren, kann sich sein Leben ebenso als Wissenschaftler wie als Komponist vorstellen.
Der Numerus clausus für jüdische Studenten verhindert die Physikerlaufbahn, er geht ans Konservatorium zunächst in Cluj (Klausenburg), später an die Budapester Musikhochschule, wo er Schüler von Veress, Járdányi und Farkas wird. Nach dem Diplom bleibt er der Hochschule als Lehrer für Musiktheorie bis 1956 treu. Dann verlässt Ligeti Ungarn, wendet sich zunächst nach Wien, später nach Köln, wo er im elektronischen Studio des WDR arbeitet. Sowohl persönlich als auch kompositorisch markiert diese Entscheidung den entscheidenden Einschnitt – er bekommt Anschluss an die Avantgarde. Als Mitarbeiter der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik ist er bald nicht mehr wegzudenken aus der heterogenen Szene der zeitgenössischen Komponisten in Deutschland. 1973 wird Ligeti zum Professor für Komposition in Hamburg berufen. Am 12. Juni 2006 stirbt er nach langer, schwerer Krankheit in Wien.
Aaron Copland
Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier
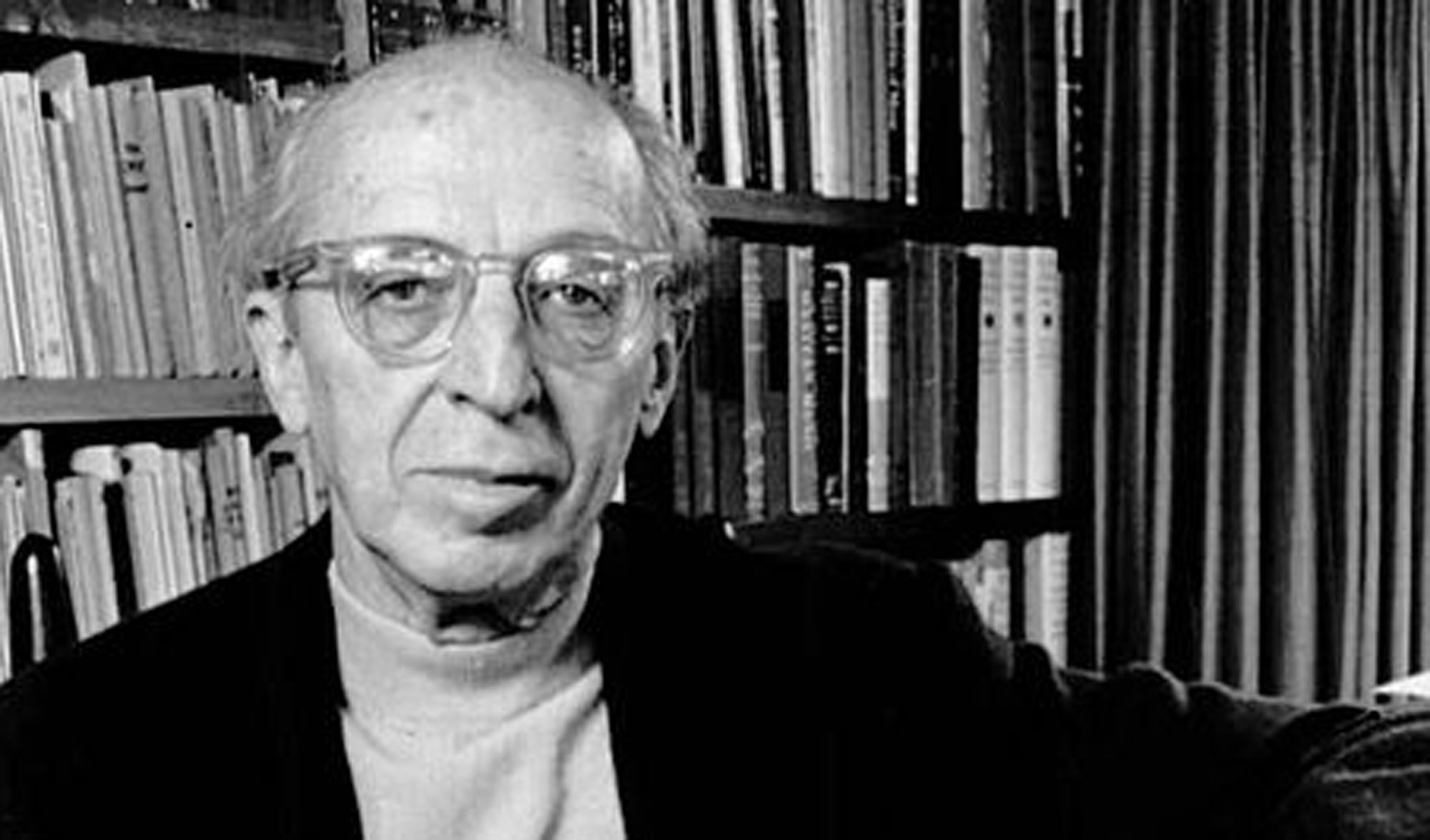
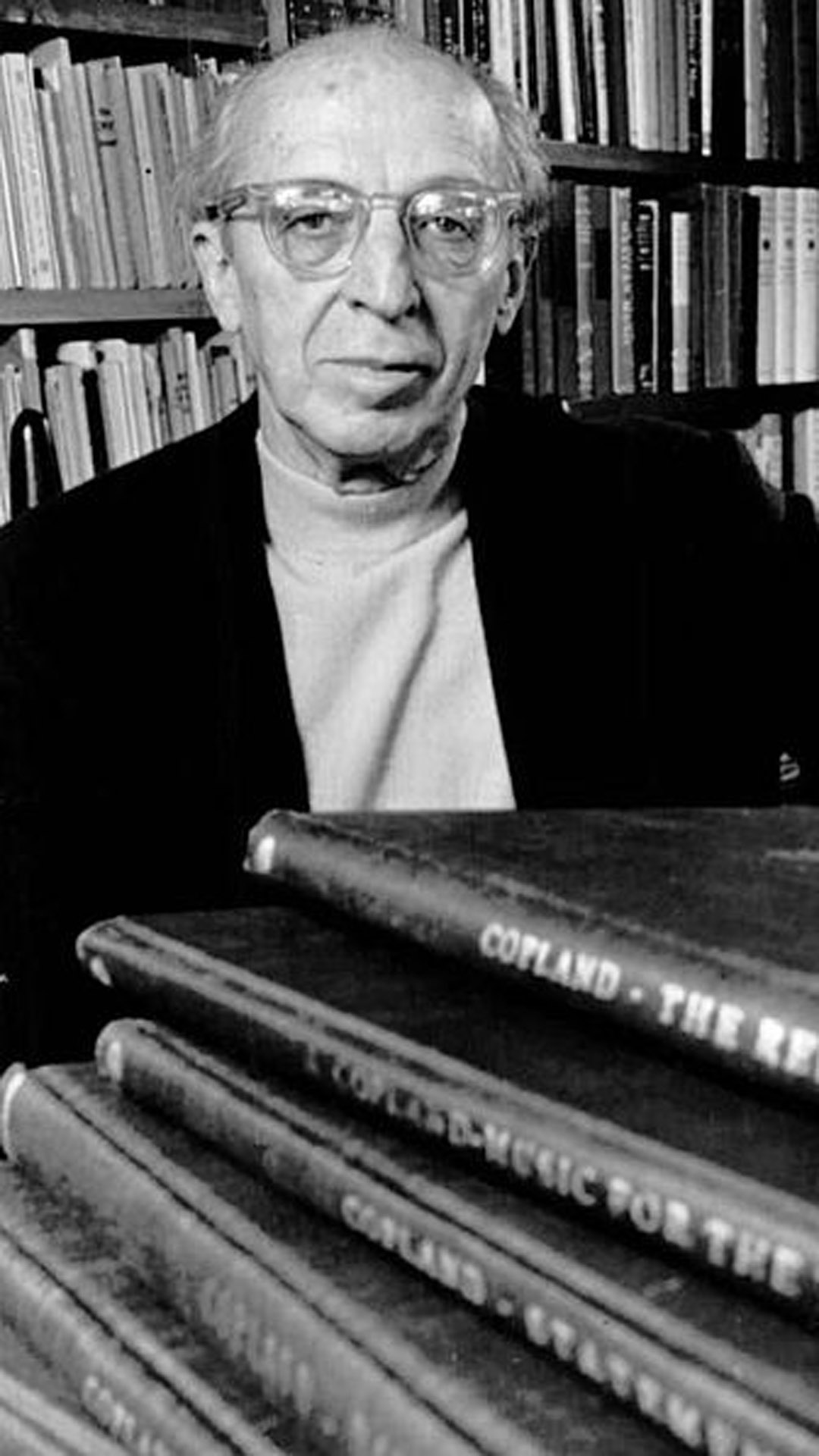
Aaron Copland, 1970
Traditional, Klassik, Jazz
Zwischen zwei orchestralen Sätzen, langsam und schnell, rangiert eine längere Solokadenz als eigener Satz, eine musikalische Architektur, die etwa auch Dmitri Schostakowitsch im ersten Violoncellokonzert verwendet. „Langsam und ausdrucksvoll“ soll das Konzert beginnen. „Ich glaube, dass alle weinen werden“, war sich Copland bereits 1947 sicher, als er die „bittersüße, grundsätzlich diatonische Lyrik“ (Philip Ramey) in Noten setzte. Erste Anklänge an den Jazz tauchen in der Solokadenz auf, wo sie sich mit diversen Volksmusiktraditionen Südamerikas vermischen und zugleich auf die Themen des Finales vorausweisen. Die Kadenz ist traditionell das virtuose Spielfeld des Solisten. Auch darin hält sich Copland an die Gepflogenheiten: „Sie ist zwar nicht so frei wie in vielen traditionellen Konzerten, aber ich war der Meinung, dass sie durchaus Spielraum für Interpretationen lässt, auch wenn ich den Ablauf ziemlich genau festgelegt habe.“


Danach geht auch im Orchester die Post ab. „Ziemlich schnell“ bohrt sich ein heftiges Synkopengewitter ins Ohr des Hörers. Copland baut eine kulturelle Brücke: „Es findet eine – unbewusste – Fusion zwischen Elementen nord- und südamerikanischer populärer Musik statt.“
Die mit der Klarinette korrespondierenden Soloinstrumente Klavier und Harfe haben vor allem perkussive Funktion, ebenso wie die Kontrabässe, deren Saiten beim Pizzikato geräuschvoll aufs Griffbrett aufzuschlagen haben. Die Wogen glätten sich nach C-Dur, um schlussendlich der Klarinette einen eindrucksvollen Abgang zu ermöglichen. Da ist Gershwins berühmte Rhapsody in Blue nicht weit!
Sergei Prokofjew
„Romeo und Julia“ – Szenen aus dem Ballett op. 64


Dieser Morgen bringt uns einen düstern Frieden, und die Sonne selbst scheint trauernd ihr Haupt verhüllt zu haben - - Geht, und erwartet unsre Entscheidung, was in diesem unglüklichen Handel Strafe und was Verzeihung verdient - - Ihr aber, getreue Liebende, die ein allzustrenges Schiksal im Leben getrennt, und nun ein freiwilliger Tod auf ewig vereiniget hat, lebet, Juliette und Romeo, lebet in unserm Andenken, und die späteste Nachwelt möge das Gedächtniß eurer unglüklichen Liebe mit mitleidigen Thränen ehren!
William Shakespeare, „Romeo und Julia“, Schlussmonolog des Fürsten von Verona (deutsch von August Wilhelm Schlegel)
Julia als Kind: Kaum zu fassen, das Girl, wie ein Wirbelwind schießt Julia durch den Morgen, spiegelt sich kurz im Wasser des Brunnens, träumt den Traum aller jungen Mädchen. Prokofjew leiht ihr die Flöte, kammermusikalisch filigran begleiten die „Freundinnen“.
Szene. Die Straße erwacht. Zögernd tänzeln die ersten Sonnenstrahlen zwischen die Füße der Frühaufsteher.
Tanz am Morgen: Er kündet von einem frischen Tag. Hoffnung keimt, doch immer drohen die Marschrhythmen.
Masken: Der abendliche Auftritt Romeos und seiner Freunde auf dem Ball der Capulets, verkleidet nach Art des Karnevals mit Masken, ist an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Romeos Übermut ist herzlich, sein Selbstbewusstsein gründet auf eigener Kraft, nicht auf der Erniedrigung eines Gegners. Peter, der später mit dem Wolf tanzt, könnte sein kleiner Bruder sein. Die Burschen wollen bloß Spaß haben, den Streit der Alten verstehen sie kaum. Artig tänzeln sie auf dem fremden Parkett. Das zweite Ich ist augenscheinlich eine reizvolle Variante der eigenen Identität.
Romeo und Julia: Ja, es könnte so schön sein. Äußerst delikat blickt Prokofjew auf den allerersten Flirt zwischen Romeo und Julia zurück: Nach beiderseits zickigen Momenten ergießt sich die Musik in breitem lyrischem Strom. Der Schachspieler Prokofjew hatte nach eigenem Bekunden anfangs seine Probleme damit. Er hielt lyrische Musik für ungeeignet, wenn schon nicht komponiert, so doch wenigstens öffentlich aufgeführt zu werden. Wie weit er in dieser Frage inzwischen gereift ist!


Tybalts Tod: Musikalisch das martialischste Stück des ganzen Balletts. Wie ein Sog zieht das Unheil alles und alle in Bann. Brutale Schläge, die lähmen, die Angst machen. Die irgendwie berauschen?
Tanz der jungen Mädchen: Im Ballett tanzen ihn die jugendlichen Freundinnen Julias mit artiger Eleganz. Sie sind auf dem Maskenball exotisch verkleidet als Antillenschönheiten, eine jede trägt eine Lilie in der Hand.
Romeos Abschied von Julia: Nach der Bluttat Romeos bleibt dem jungen Paar nur die Trennung, Schmerz ohne Sentimentalität. Der Abschied ist eine leise Sache. „Um nicht schlüpfrig zu werden, suchte der Komponist eine reine, lichte Musik“ (Prokofjew, 1935). Musikalisches Material aus dem dritten Akt führt uns in Julias Schlafzimmer, lässt uns an ihren Träumen teilhaben, zeichnet den Schmerz des seine Geliebte verlassenden Romeo, malt seine vollmundigen Wiederkommensbekundungen.
Am Ende ist Julia allein, die Musik dreht sich gemeinsam mit ihr buchstäblich auf der Stelle. Einer anderweitigen Verheiratung versucht sie, durch Scheintod zu entkommen.
Julias Tod: Rasend vor Schmerz, eilt Romeo zurück nach Verona, um an ihrer Seite zu sterben. Im Grabgewölbe sieht er die leblose Julia liegen und erdolcht sich. Julia erwacht und folgt ihm in den Tod. Julias Mutter, die Gräfin Capulet, steht vor den Trümmern ihres Lebens.
Kurzbiographien, Abendbesetzung
Lahav Shani

Seit der Saison 20/21 ist Lahav Shani Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra, und hiermit die Nachfolge von Zubin Mehtas, der diese Position 50 Jahren innehielt. Shani ist seit 2017 auch Hauptgastdirigent der Wiener Symphoniker.
Shanis enge Beziehung zum Israel Philharmonic Orchestra begann vor über 10 Jahren. Er debütierte mit dem Orchester im Alter von 16 Jahren und führte 2007 das Tschaikowsky-Pianokonzert unter der Leitung von Zubin Mehta im Alter von 18 Jahren auf. Anschließend spielte er regelmäßig als Kontrabassist mit dem Orchester. Nach dem er den Internationalen Dirigentenwettbewerb Gustav Mahler in Bamberg im Jahr 2013 gewann, lud ihn das Orchester ein, die Konzerte zur Saisoneröffnung zu dirigieren. Seitdem kehrt er jedes Jahr sowohl als Dirigent als auch als Pianist an das Orchester zurück, um unter anderem das Abschlusskonzert der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum des Orchesters im Dezember 2016 zu leiten.
Shani wurde 1989 in Tel Aviv geboren und begann sein Klavierstudium im Alter von sechs Jahren bei Hannah Shalgi, bevor er mit Prof. Arie Vardi an der Buchmann-Mehta School of Music fortfuhr. Anschließend studierte er das Dirigieren bei Prof. Christian Ehwald, sowie Piano bei Prof. Fabio Bidini an der Musikakademie Hanns Eisler in Berlin; und wurde während seiner Zeit dort von Daniel Barenboim betreut.
Shani arbeitet regelmäßig mit der Staatskapelle Berlin zusammen, sowohl in Opernproduktionen, an der Staatsoper Berlin, als auch für symphonische Konzerte. Zu den jüngsten und kommenden Höhepunkten in der Rolle des Gastdirigenten zählen Engagements mit den Wiener Philharmonikern, dem Gewandhausorchester, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Berliner Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Philadelphia Orchestra, dem Budapest Festival Orchestra, dem Orchestre de Paris und dem Philharmonia Orchestra.
Martin Fröst

Martin Fröst ist international als hochvirtuoser Klarinettist, origineller Musikvermittler und inspirierender Dirigent bekannt. Das Streben nach der Neugestaltung klassischer Musik und die Suche nach neuen Herausforderungen zeichnen ihn ebenso aus wie ein umfassendes Repertoire. Es besteht aus gesetzten Klarinettenwerken, aber auch aus einer Reihe zeitgenössischer Kompositionen, für die er sich nachdrücklich einsetzt. Für sein Spiel wurde er 2014 als erster Klarinettist mit einer der höchsten musikalischen Auszeichnungen der Welt, dem „Léonie-Sonning-Musikpreis“, geehrt.
Als Solist konzertierte der aus Schweden gebürtige Musiker mit weltbekannten Orchestern wie dem New York und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Münchner Philharmonikern und dem NDR-Elbphilharmonie Orchester. Beim RSB war er 2013 zum ersten Mal zu Gast. Regelmäßig arbeitet er mit Künstler:innen wie Yuja Wang, Janine Jansen und Roland Pöntinen zusammen. Er spielt bei internationalen Festivals und tourt durch ganz Europa, nach Nordamerika, Asien und Australien.
Martin Frösts Interesse gilt nicht nur der ständigen Neufindung der Musik, er setzt sich auch stark für musikalischen Erziehung ein. So gründete er 2019 die Martin-Fröst-Stiftung, die für Kinder und Jugendliche einen besseren Zugang zu Musikinstrumenten und -unterricht ermöglichen soll und bereits in Kenia und Madagaskar vertreten ist.


RSB-Abendbesetzung
Violine 1
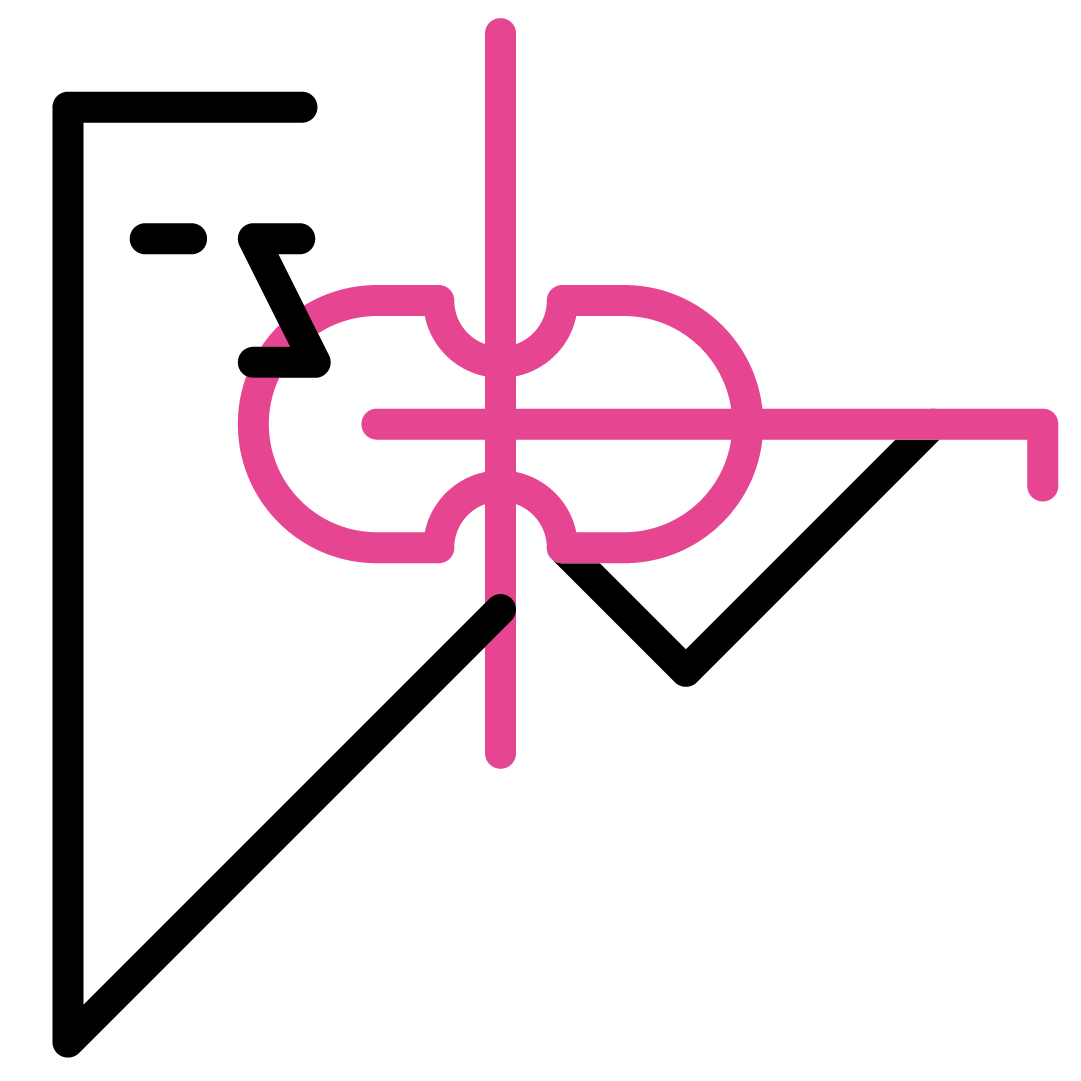
Ofer, Erez
Nebel, David
Herzog, Susanne
Yoshikawa, Kosuke
Neufeld, Andreas
Bondas, Marina
Beckert, Philipp
Kynast, Karin
Tast, Steffen
Morgunowa, Anna
Feltz, Anne
Yamada, Misa
Hildebrandt, Laura
Scilla, Giulia
Kang, Jiho
Heidt, Cathy
Violine 2
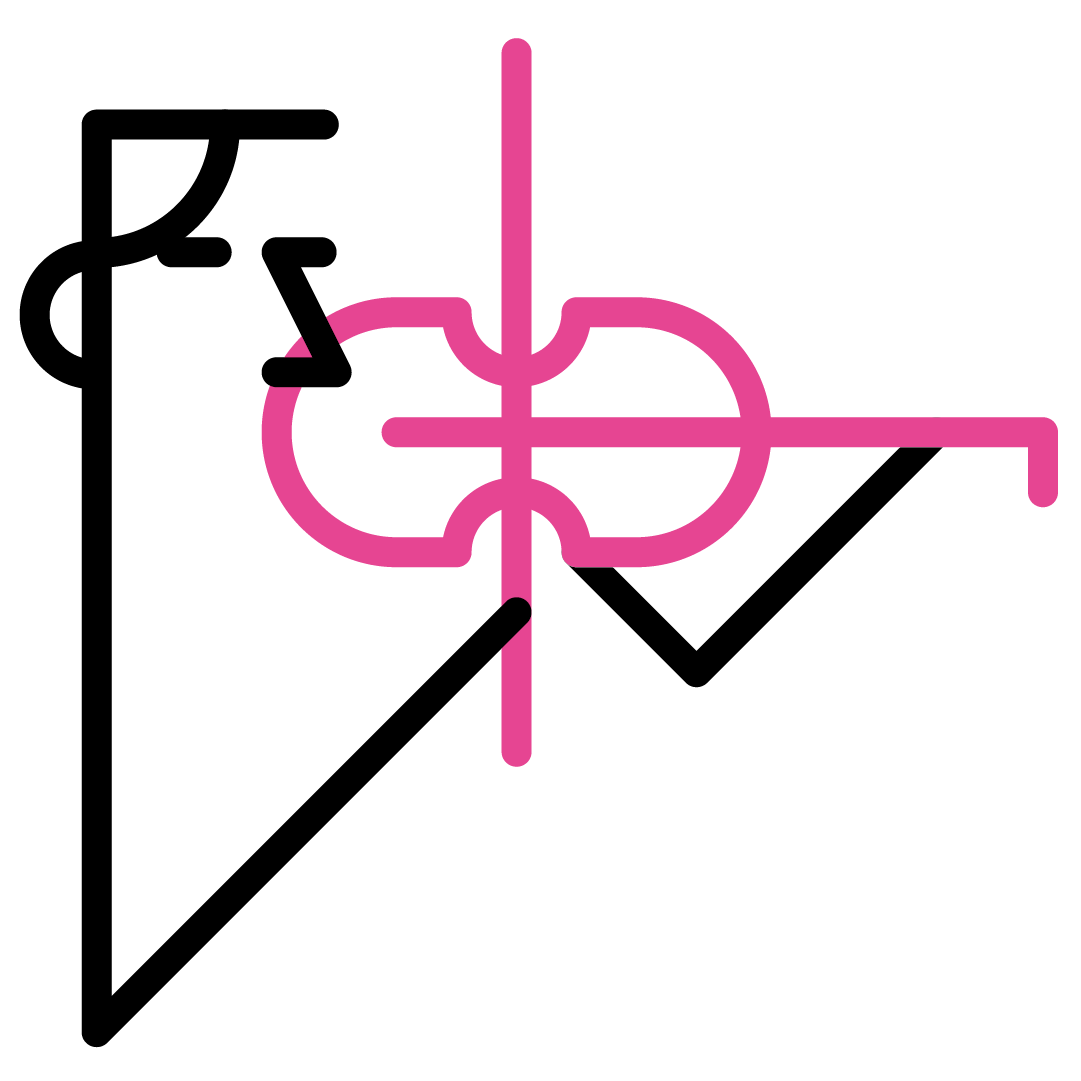
Contini, Nadine
Simon, Maximilian
Drop, David
Petzold, Sylvia
Draganov, Brigitte
Eßmann, Martin
Buczkowski, Maciej
Hetzel de Fonseka, Neela
Bauza, Rodrigo
Färber-Rambo, Juliane
Palascino, Enrico
Leung, Jonathan
Guiller, Antoine
Marquard, David
Viola

Regueira-Caumel, Alejandro
Adrion, Gernot
Silber, Christiane
Zolotova, Elizaveta
Markowski, Emilia
Drop, Jana
Doubovikov, Alexey
Montes, Carolina
Nell, Lucia
Shin, Hyeri
Balan-Dorfman, Misha
Kantas, Dilhan
Violoncello
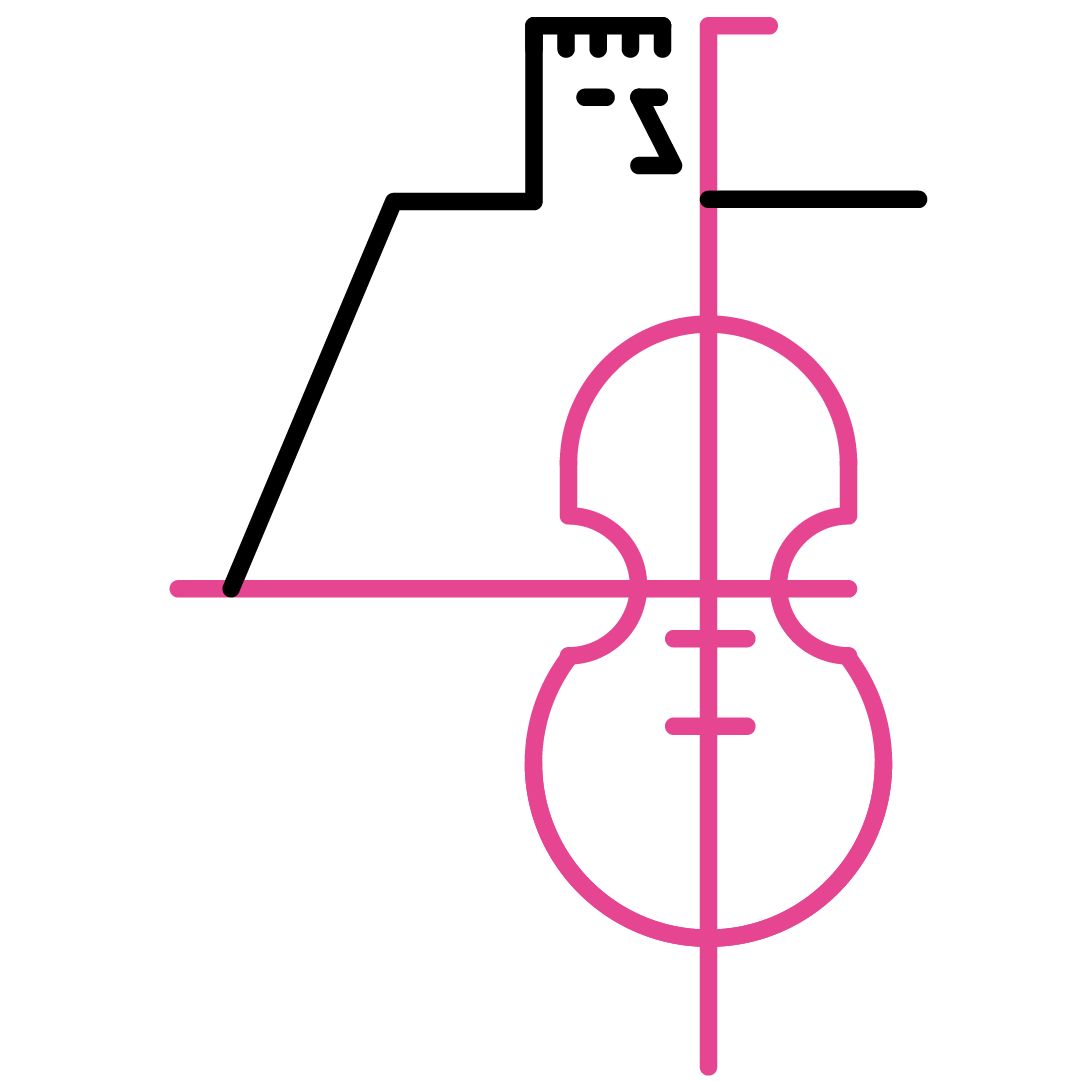
Eschenburg, Hans-Jakob
Riemke, Ringela
Breuninger, Jörg
Weiche, Volkmar
Boge, Georg
Weigle, Andreas
Bard, Christian
Kipp, Andreas
Kalvelage, Anna
Kim, Jean
Kontrabass
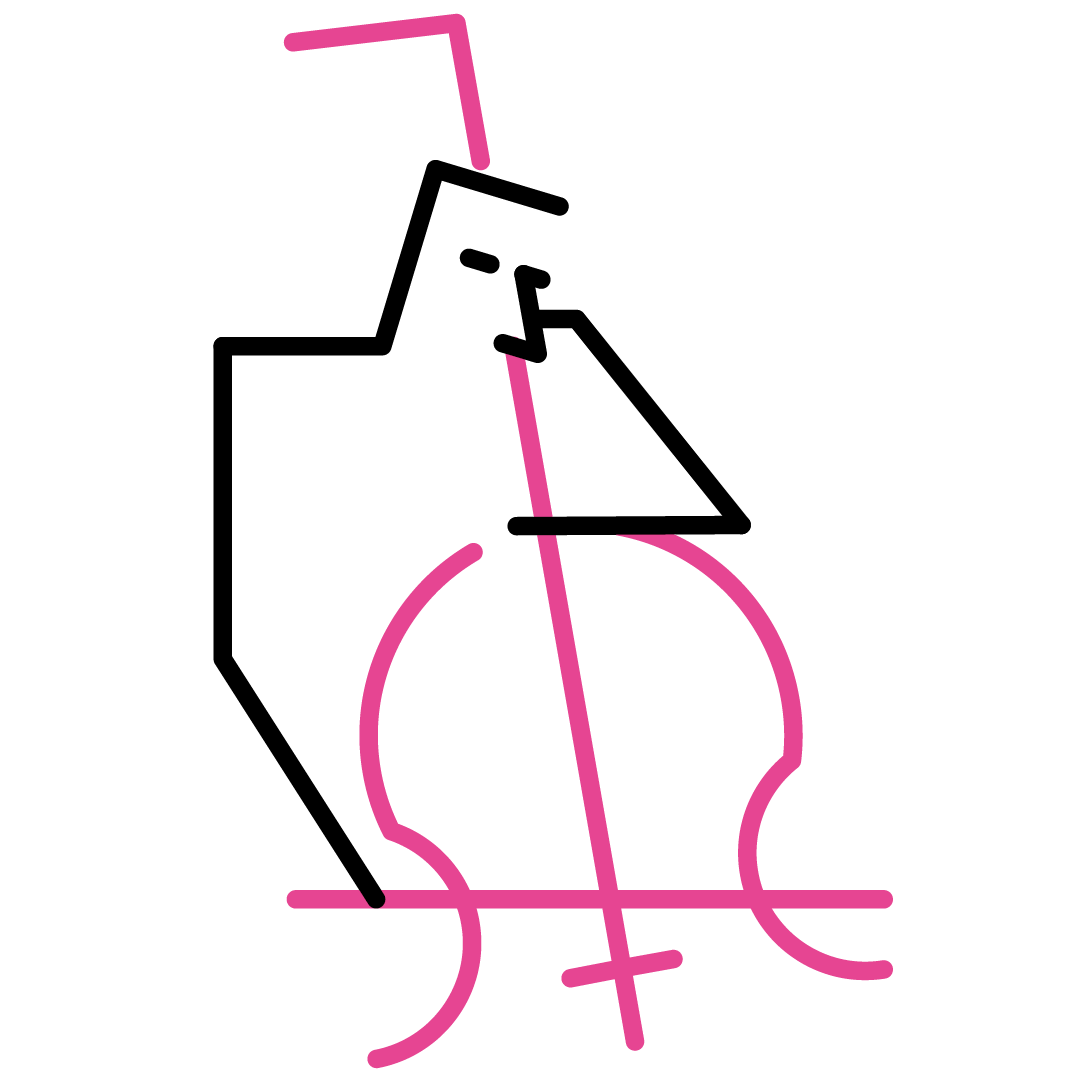
Wagner, Marvin
Schwärsky, Georg
Buschmann, Axel
Ahrens, Iris
Gazale, Nhassim
Nejjoum-Barthélémy, Mehdi
Thüer, Milan
Wheatley, Paul
Flöte
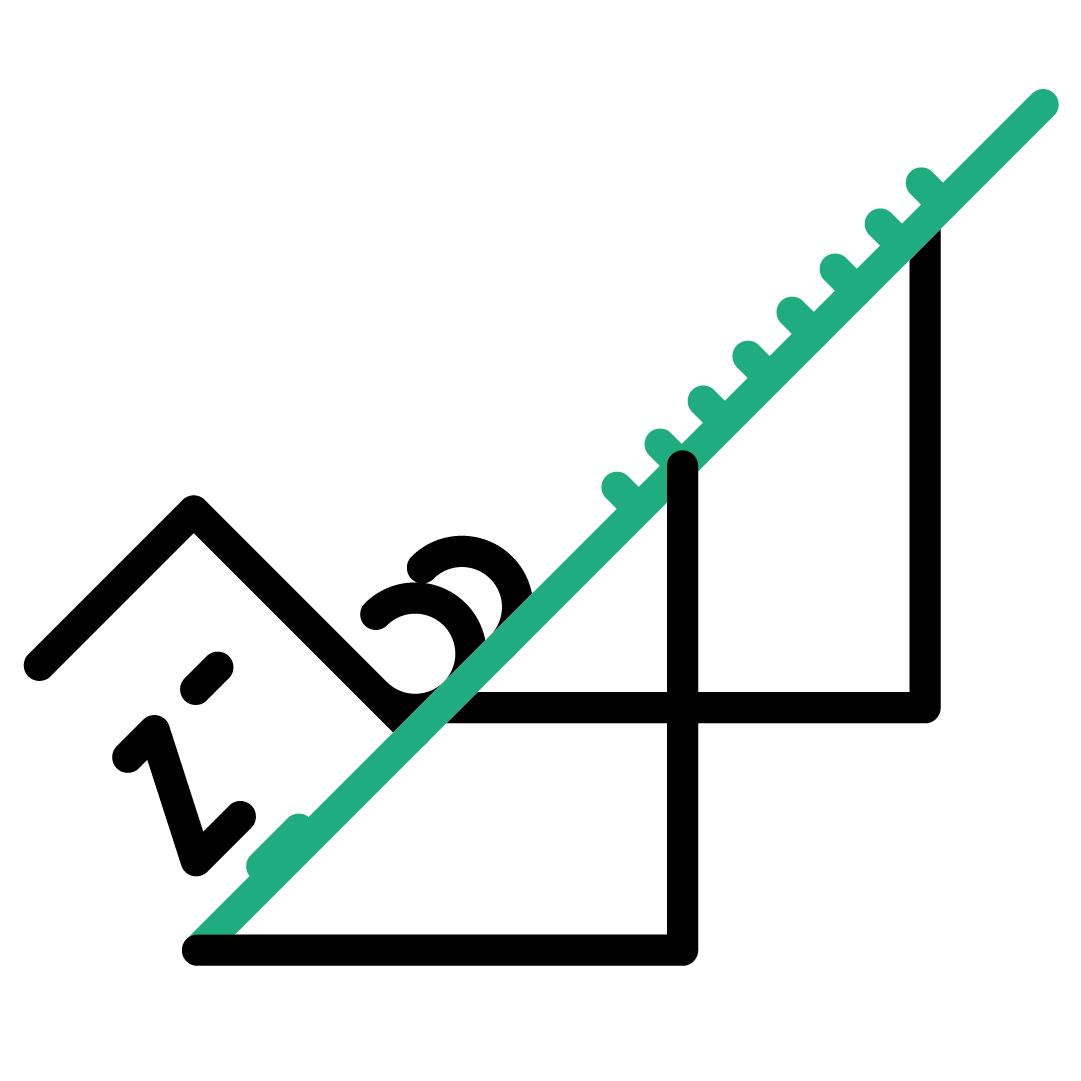
Uhlig, Silke
Döbler, Rudolf
Schreiter, Markus
Kronbügel, Annelie
Oboe
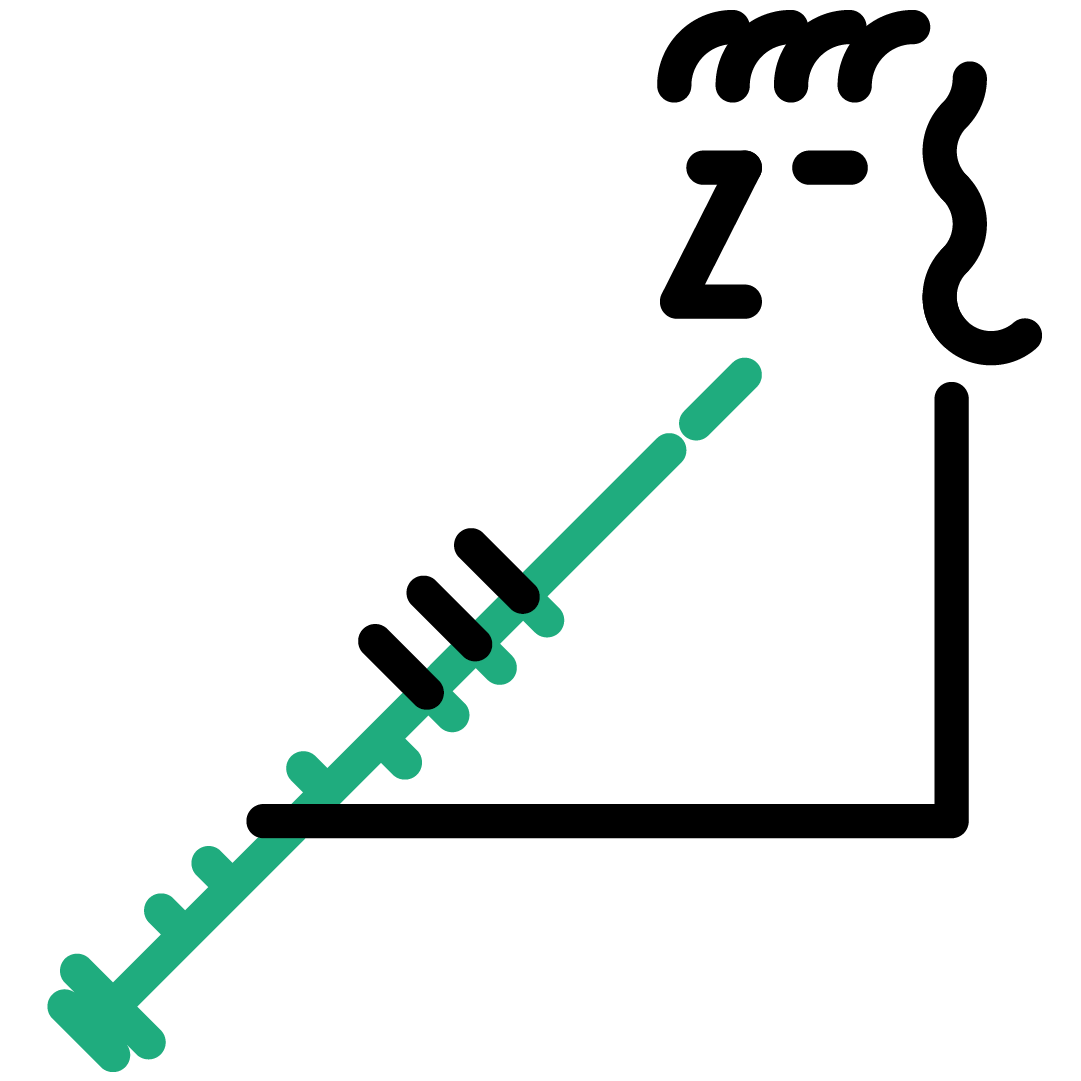
Esteban Barco, Mariano
Grube, Florian
Vogler, Gudrun
Herzog, Thomas
Klarinette
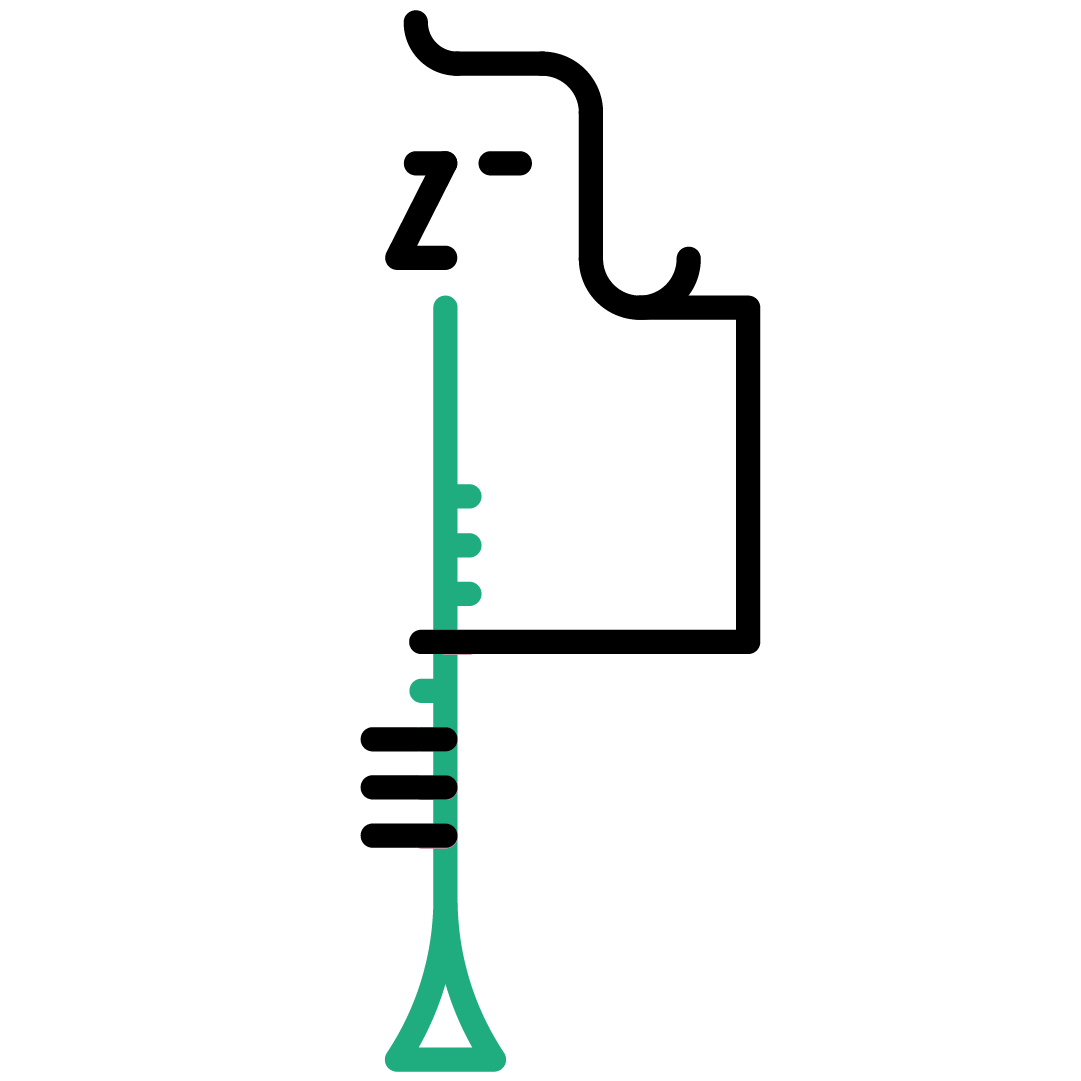
Link, Oliver
Pfeifer, Peter
Zacharias, Ann-Kathrin
Pfanzelt, Barbara
Saxophon
Elßner, Karola
Fagott
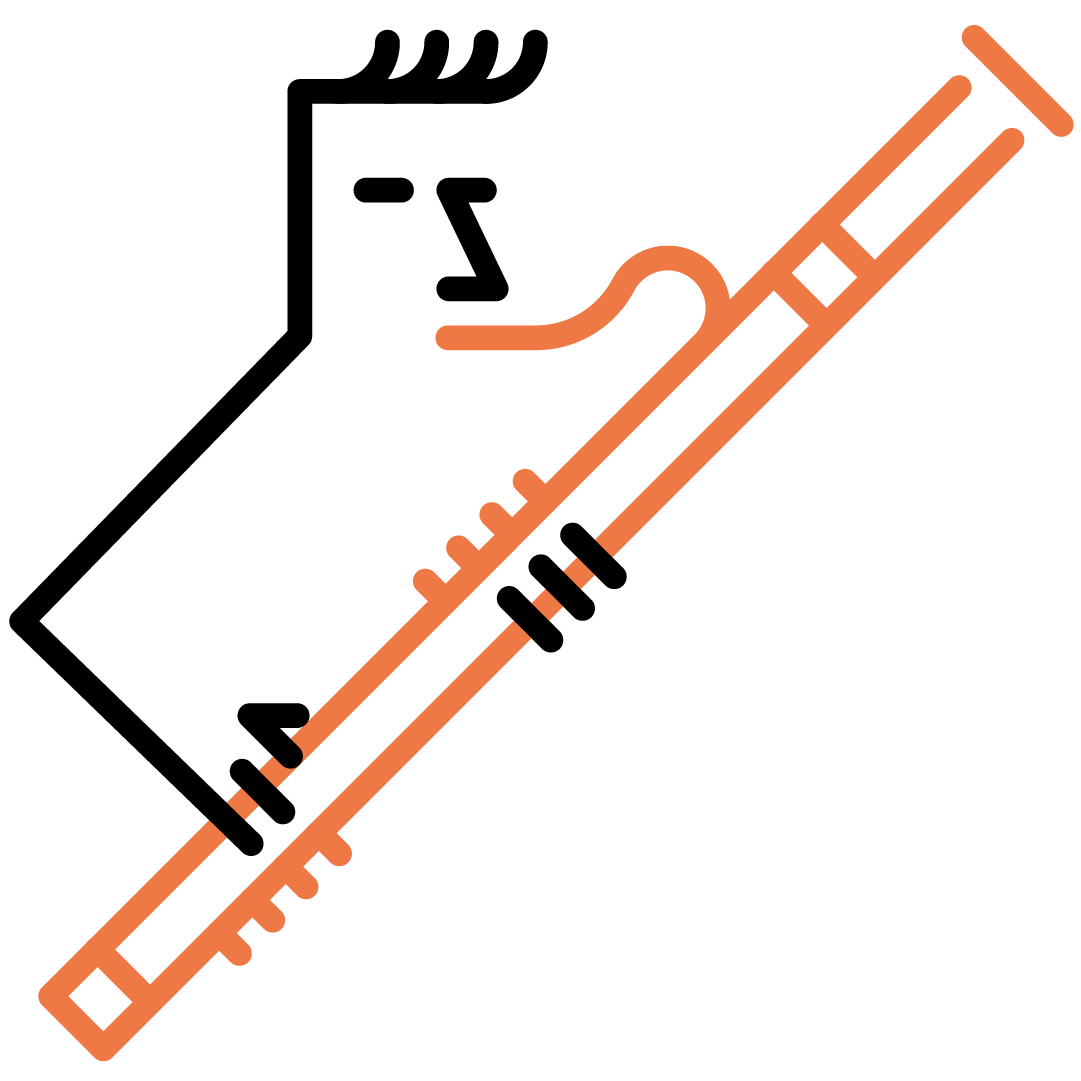
Kofler, Miriam
Voigt, Alexander
Okulmus, Vedat
Kopf, Mario
Horn

Kühner, Martin
Holjewilken, Uwe
Klinkhammer, Ingo
Mentzen, Anne
Stephan, Frank
Hetzel de Fonseka, Felix
Trompete

Dörpholz, Florian
Ranch, Lars
Niemand, Jörg
Gruppe, Simone
Hofer, Patrik
Posaune
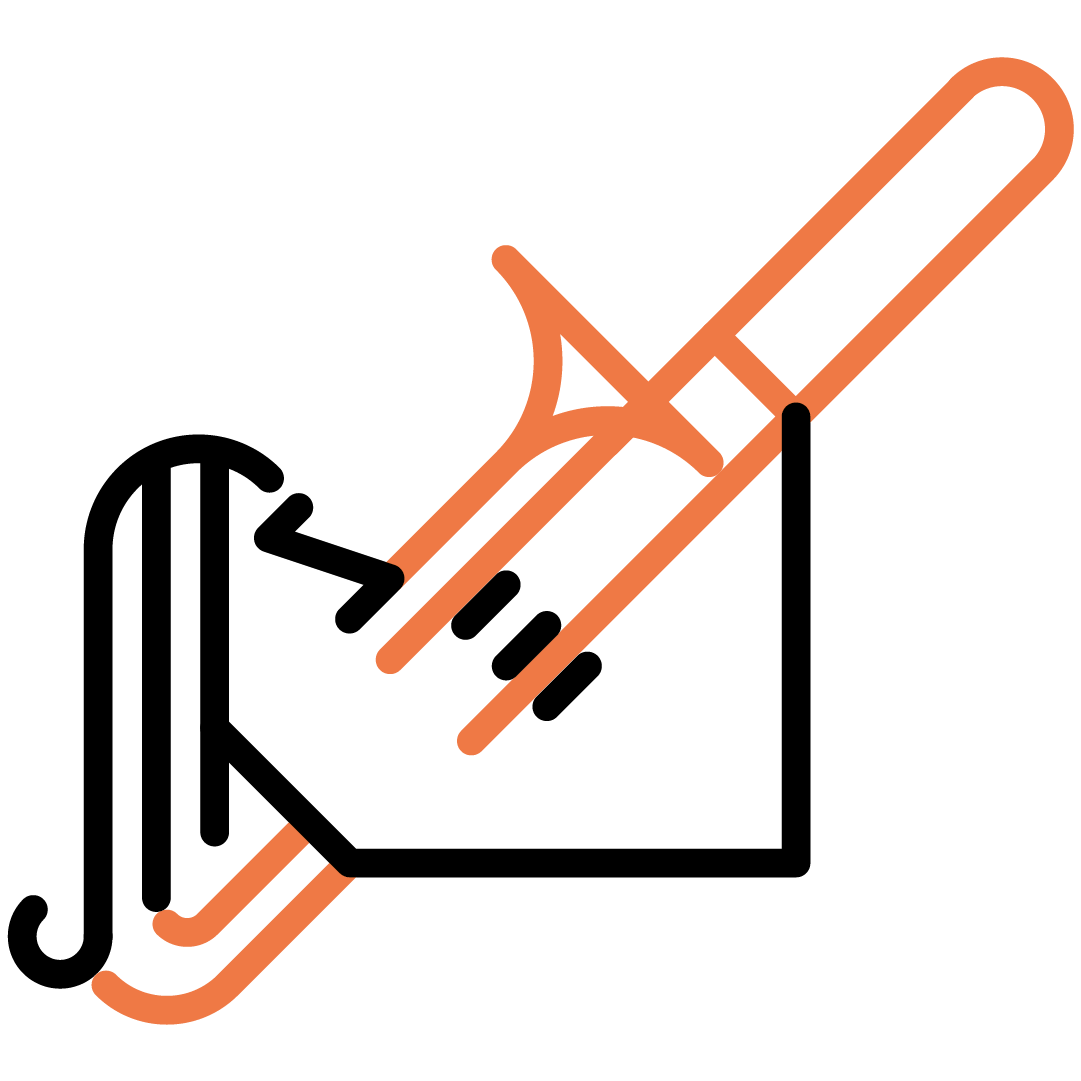
Manyak, Edgar
Hauer, Dominik
Lehmann, Jörg
Tuba
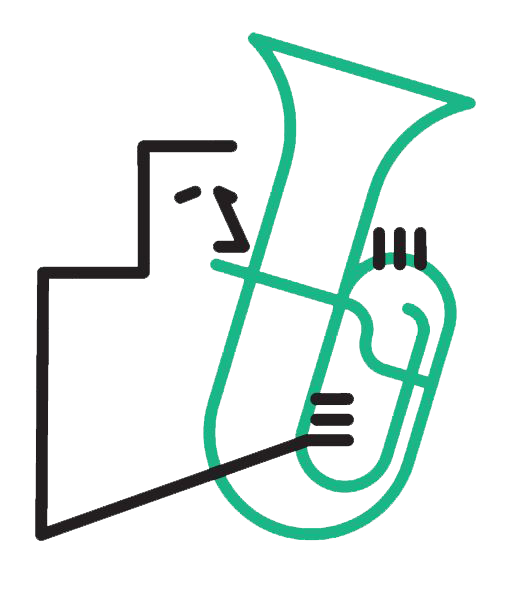
Gionanidis, Vikentios
Harfe

Edenwald, Maud
Schlagzeug

Schweda, Tobias
Tackmann, Frank
Morbitzer, Wolfgang
Grahl, Christoph
Pauke
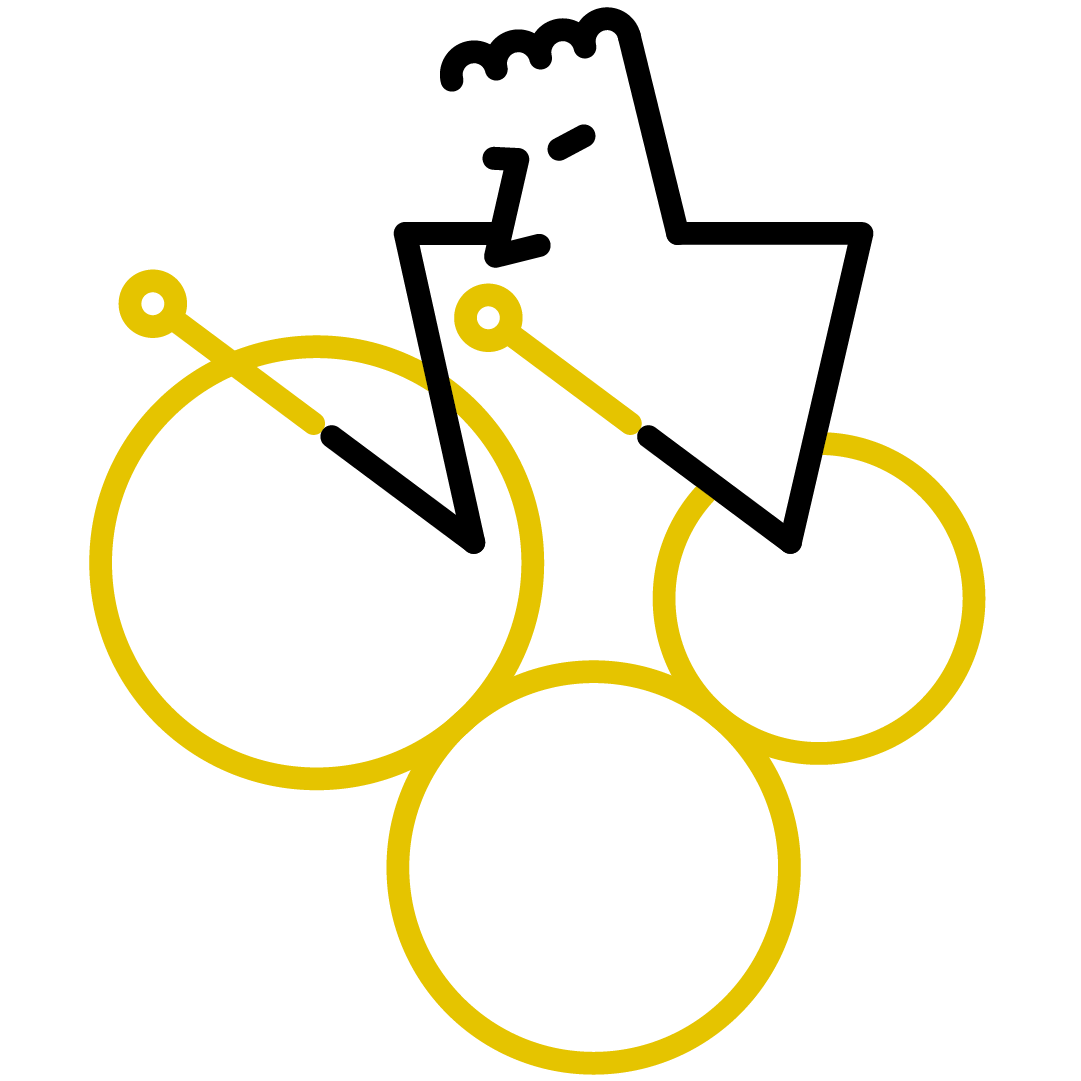
Wahlich, Arndt
Klavier
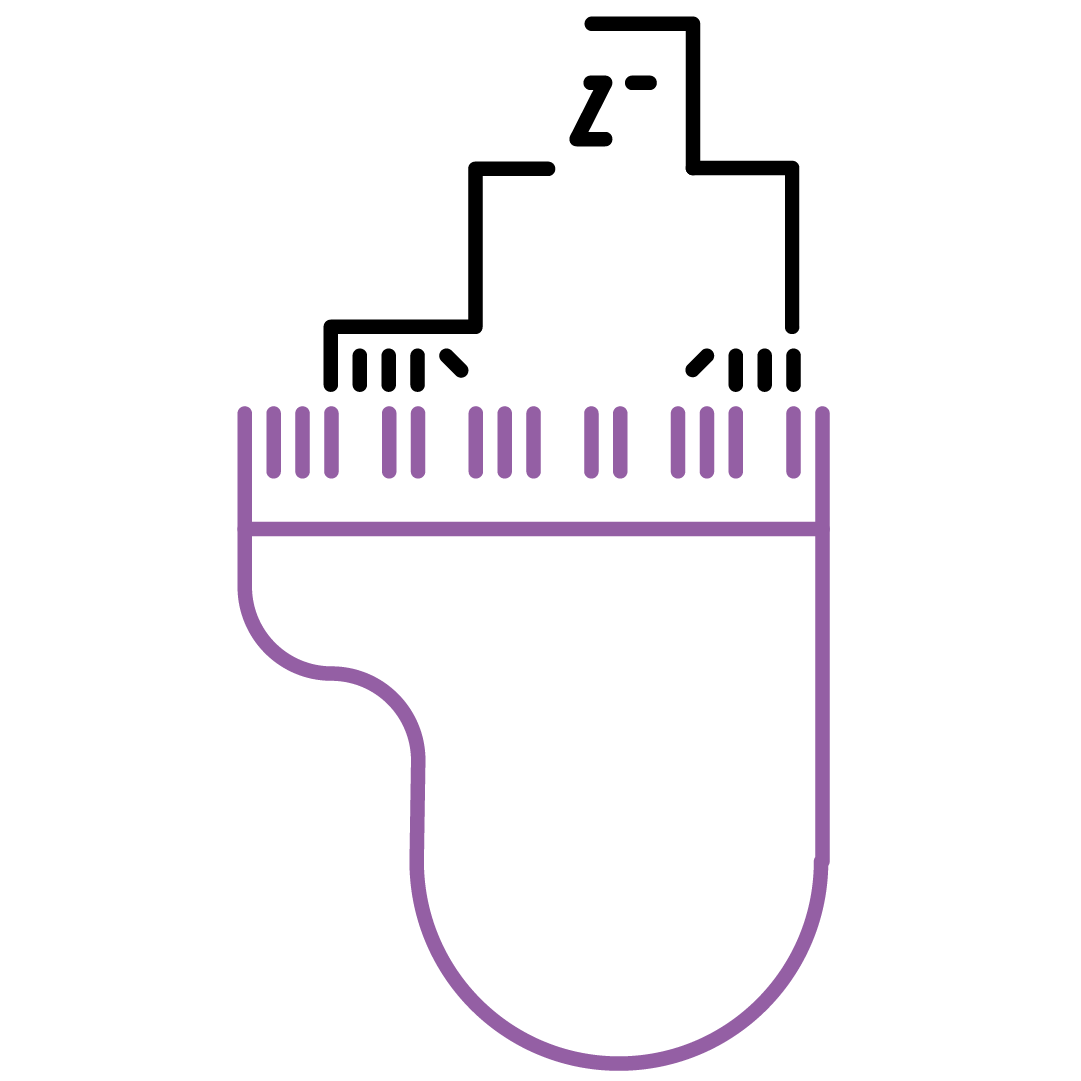
Gneiting, Heike
Inagawa, Yuki
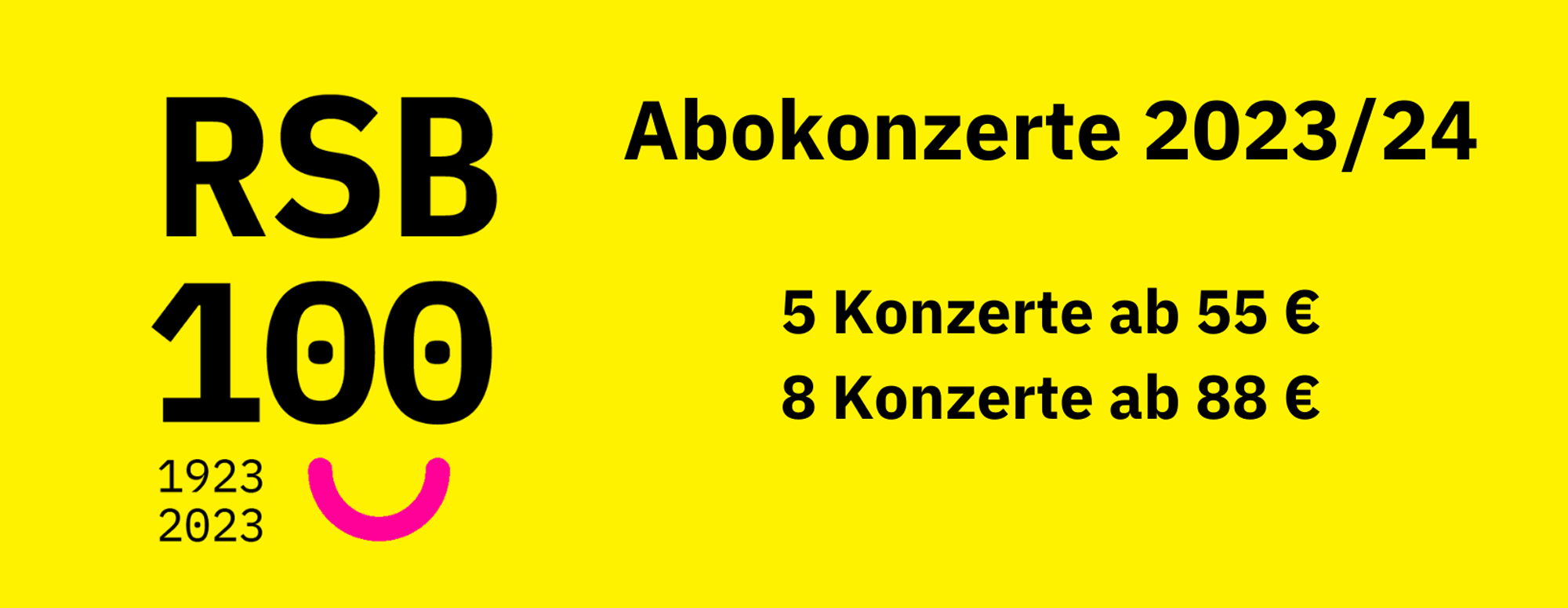
Kooperationspartner

Radioübertragung am 11.06. um 20:03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur
Martin Fröst tritt mit freundlicher Genehmigung von Sony Classical, einem Label von Sony Music Entertainment, auf.
Bild- und Videoquellen
Portrait Laha Shani © Marco Borggreve
Portrait Martin Fröst © Mats Bäcker
Bilder Orchester und Probenbilder © Peter Meisel