

Digitales Programm
Sa 23.12. Marc Minkowski
19:00 Philharmonie
Ernest Chausson
„Poème de l’amour et de la mer“ für mittlere Stimme und Orchester op. 19
Jean Phillippe Rameau
Suite für Orchester aus der Oper „Les Boréades“
Pause
Anton Bruckner
Sinfonie d-Moll WAB 100 (anullierte Sinfonie Nr. 2)
Besetzung
Marc Minkowski, Dirigent
Florian Sempey, Bariton
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Konzerteinführung: 18.10 Uhr, Südfoyer, Konzerteinführung von Steffen Georgi
Das Konzert wird am 12.01.2024 20.03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur übertragen.
Podcast „Muss es sein?“
Werke
Ernest Chausson
„Poeme de l’amour et de la mer“ für mittlere Stimme und Orchester op. 19


Die unbekannte Insel
So lässt sich die Spur des „Poème de l’amour et de la mer“ zurückverfolgen bis zum denkwürdigen Orchesterliederzyklus „Nuits d’été“ von Hector Berlioz. Der hat die Gedichte dafür dem zweiten Band der „Comédie de la mort“ von Theophile Gautier entnommen.
Die Suche nach der idealen Insel, wo Liebe und Freude, Sinne und Künste eins sind – Berlioz und Gautier (dessen 32-jährige Tochter Judith noch 1877 den Verführungskünsten des 64-jährigen Wagner erlag) gaben sie irgendwann auf. Wagner baute sich nach langem, vergeblichem Suchen selbst seine Insel in Bayreuth. Für Zemlinsky und Schreker entpuppte sich die Insel (nach Oscar Wildes „Eine Florentinische Tragödie“) später als Hort des Lasters. Rachmaninow und Reger erkannten die ihre in Böcklins „Toteninsel“. Debussy durchpflügte „la mer“, ohne ein Eiland anzusteuern, Ravel verlegte seine selige Insel schließlich weit weg, ins Land von Shéhérazade. Tristan Klingsor (Wagner lässt grüßen) schrieb ihm die Gedichte dafür.
Wagner am Meer
Wenn Berlioz und Ravel, Franck und Debussy die Suche mit französischem Sinn für Ironie und einem Rest lebensfroher Sorglosigkeit betrieben haben, so bewegt sich Chausson im Schatten von Wagners düsterem Ahnen. Das „Poème de l‘amour et de la mer“ op. 19 komponiert er auf Texte von Maurice Bouchor (1855-1929), einem Mode-Literaten, mit dem Chausson die Abneigung gegen die Juristerei und die Begeisterung für Wagner teilt, und auf dessen Texte er bereits seine ersten Lieder komponiert hat. Chausson überflutet die sentimental-resignativen Texte mit einer überbordend phantasievollen Musik. Fein ausgehörte Klangsinnlichkeit, schwärmerische Fülle, üppige Harmonien tragen zwei Gedichte, die von Liebeshoffnung und -entsagung künden, wie sie am Meeresufer die Seele erfassen können.


Klang, der zu Farbe wird und in sich ruht, ein freies Schweben zwischen den Akkorden weisen auf den Impressionismus und auf Debussy voraus, der Chausson viel zu verdanken hat und der das Vermächtnis des Älteren 1913 in einer Schrift „Einsame Gespräche mit Monsieur Croche“ so charakterisiert: „Freiheit der Form, harmonische Proportionen und träumerische Süße“.
Von 1882 bis 1890 und noch einmal 1893 arbeitet der gewissenhafte Chausson am „Poème de l‘amour et de la mer“. Zwei Gesangsteile umrahmen ein rein orchestrales Zwischenspiel, wie überhaupt das Orchester wichtige Botschaften übermittelt – auch hier ist Chausson ganz nahe bei Wagner.
Das erste Lied durchlebt blumige „Naturpoesie, liebevolle Nostalgie bis hin zu bitterem Schmerz – der wiederum, dem Text entsprechend, von einer frischen Meeresbrise und spritzenden Schaumkronen weggewaschen wird.“ (David Wright)
Das Zwischenspiel schaut nach innen, porträtiert den enttäuscht Liebenden. Mit Flötentrillern und rauschenden Arpeggien kehrt das Meer zurück, um das letzte Lied anzustimmen. Was zunächst funkelt und glitzert, erfährt eine jähe Wendung bei den Worten „meine Gedanken wirbeln umher wie tote Blätter in der Nacht“. Auf den Satz schließlich „Mir gefror das Blut, als ich das fremde Lächeln meiner Liebsten sah“ stürzt sich Chausson mit vehementer Leidenschaft. Dabei wagt er sich weit vor in Regionen voller zerrissener Chromatik. Mit dem schicksalhaften Wort „Vergessen“ schließt sich der Kreis zum Beginn des ersten Liedes
Ernest Amédée Chausson
„Poème de l’amour et de la mer“
Text von Maurice Bouchor
„La fleur des eaux“
L’air est plein d’une odeur exquise de lilas,
Qui, fleurissant du haut des murs jusques en bas,
Embaument les cheveux des femmes.
La mer au grand soleil va toute s’embrasser,
Et sur le sable fin qu’elles viennent baiser
Roulent d’éblouissantes lames.
O ciel qui de ses yeux dois porter la couleur,
Bri se qui vas chanter dans les lilas en fleur
Pour en sortir tout embaumée,
Ruisseaux, qui mouillerez sa robe,
O verts sentiers,
Vous qui tressaillerez sous ses chers petits pieds,
Faites-moi voir ma bien aimée!
Et mon coeur s’est levé par ce matin d’été;
Car une belle enfant était sur le rivage,
Laissant erer sur moi des yeux pleins de clarté,
Et qui me souriait d’un air tendre et sauvage.
Toi que transfiguraient la Jeunesse et l’Amour,
Tu m’apparus alors comme l’âme des choses;
Mon coeur vola vers toi, tu le pris sans retour,
Et du ciel entr’ouvert pleuvaient sur nous des rosés.
Quel son lamentable et sauvage
Va sonner l’heure de l’adieu!
La mer roule sur le rivage,
Moqueuse, et se souciant peu
Que ce soit l’heure de l’adieu.
Des oiseaux passent, l’aile ouverte,
Sur l’abîme presque joyeux;
Au grand soleil la mer est verte,
Et je saigne, silencieux,
En regardant briller les cieux.
Je saigne en regardant ma vie
Qui va s’éloigner sur les flots;
Mon âme unique m’est ravie
Et la sombre clameur des flots
Couvre le bruit de mes sanglots.
Qui sait si cette mer cruelle
La ramènera vers mon coeur?
Mes regards sont fixés sur elle;
La mer chante, et le vent moqueur
Raille l’angoisse de mon coeur.
Interlude
„La mort de l’amour“
Bientôt l’île bleue et joyeuse
Parmi les rocs m’apparaîtra;
L’île sur l’eau silencieuse
Comme un nénuphar flottera.
A travers la mer d’améthyste
Doucement glisse le bateau,
Et je serai joyeux et triste
De tant me souvenir Bientôt!
Le vent roulait les feuilles mortes;
Mes pensées
Roulaient comme des feuilles mortes,
Dans la nuit.
Jamais si doucement au ciel noir n’avaient lui
Les mille rosés d’or d’où tombent les rosées!
Une danse effrayante, et les feuilles froissées,
Et qui rendaient un son métallique, valsaient,
Semblaient gémir sous les étoiles, et disaient
L’inexprimable horreur des amours trépassés.
Les grands hêtres d’argent que la lune baisait
Etaient des spectres: moi, tout mon sang se glaçait
En voyant mon aimée étrangement sourire.
Comme des fronts de morts nos fronts avaient pâli,
Et, muet, me penchant vers elle, je pus lire
Ce mot fatal écrit dans ses grands yeux: l’oubli.
Let temps des lilas et le temps des rosés
Ne reviendra plus à ce printemps-ci;
Le temps des lilas et le temps des rosés
Est passés, le temps des oeillets aussi.
Le vent a changé, les cieux sont moroses,
Et nous n’irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles rosés;
Le printemps est triste et ne peut fleurir.
Oh! joyeux et doux printemps de l’année,
Qui vins, l’an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d’amour est si bien fanée,
Las! que ton baiser ne peut l’éveiller!
Et toi, que fais-tu? pas de fleurs écloses,
Point de gai soleil ni d’ombrages frais;
Le temps des lilas et le temps des rosés
Avec notre amour est mort à jamais.
ERNEST CHAUSSON
Gedicht über die Liebe und das Meer
Die Blume der Wasser
Ein edler Fliederduft liegt in der Luft
von Blüten, die die Mauern umranken
und das Haar der Frauen duften lassen.
In helles Sonnenlicht getaucht,
leuchtet das Meer, und auf dem feinen Sand,
gerade noch von ihnen geküsst,
vergehen glitzernde Wellen.
O Himmel, der die Farbe ihrer Augen spiegelt,
Windhauch, der zwischen den Fliederblüten singt
und duftgeschwängert weiterzieht,
Bäche, die ihr Kleid benetzen,
o gräserne Pfade, die unter ihren teuren, kleinen Füßen beben,
lasst mich meine Liebste sehen!
Mein Herz erwachte an jenem Sommermorgen;
denn am Ufer stand ein schönes Madchen,
das seinen klaren Blick über mich schweifen ließ
und dabei lächelte, zugleich zart und wild.
Du, von Liebe und Jugend verklärt,
schienst mir damals die Seele der Natur selbst zu sein:
mein Herz öffnete sich dir, du nahmst es auf ewig,
und Rosen regneten auf uns herab aus dem sich öffnenden Himmel.
Welch wilde Klage wird in der Stunde des Abschieds aufklingen!
Die See wallt über die Ufer, die Stunde des Abschieds gleichgültig verspottend.
Vögel gleiten mit ausgebreiteten Flügeln sorglos über die Tiefe,
in helles Sonnenlicht getaucht, leuchtet das Meer smaragdgrün,
und ich trauere still, während ich in den herrlichen Himmel blicke.
Ich trauere, weil ich die Wogen mein Leben davontragen sehe;
meine eigene Seele wird mir genommen,
das gleichmäßige Rauschen der Wellen
läßt den Klang meiner Schluchzer untergehen.
Wer weiß, ob diese grausame See
sie meinem Herzen zurückbringen wird?
Meine Augen sind nur auf sie gerichtet;
das Meer singt, und der spottende Wind
verhöhnt die Qualen meines Herzens.
Zwischenspiel
Der Tod der Liebe
Sehr bald wird die blaue Insel des Glücks
zwischen den Felsen auftauchen;
sie schwimmt auf dem ruhigen Wasser
wie eine Seerose.
Über das amethystfarbene Meer
gleitet das Boot sanft dahin,
und ich werde Freude und Leid empfinden
in vielen Erinnerungen – schon bald.
Wind wirbelt die toten Blatter umher,
meine Gedanken wirbeln umher wie tote Blätter in der Nacht,
Unzählige goldene Rosen, von denen der Tau tropft,
haben noch nie so zart vom schwarzen Himmel geleuchtet!
In phantastischem Tanz
bewegen sich welke Blätter im Walzertakt
mit metallischem Klang,
sie scheinen unter Sternen zu stöhnen,
von der namenlosen Qual gestorbener Liebe zu erzählen.
Mächtige Silberbuchen, vom Monde geküsst,
erscheinen wie Geister:
Mir gefror das Blut,
als ich das fremde Lächeln meiner Liebsten sah.
Unsere Gesichter waren totenblass,
und als ich mich stumm an sie lehnte,
konnte ich jenes Wort des Verderbens
in ihren weit offenen Augen lesen:
Vergessen.
Die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen
wird in diesem Frühling nicht wiederkehren;
die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen ist vorbei –
genau wie die Zeit der Nelken.
Es weht ein anderer Wind,
der Himmel ist trübe,
wir werden nicht mehr laufen
und den blühenden Flieder und die schönen Rosen pflücken,
der Frühling ist traurig und kann nicht erblühen!
Oh! Wie süß und froh der Frühling war,
der uns vergangenes Jahr in Sonnenschein tränkte!
Die Blume unserer Liebe ist verblüht,
dass nicht einmal dein Kuss sie wiederbeleben kann!
Und du, was tust du?
Keine blühenden Blumen,
weder strahlender Sonnenschein noch kühler Schatten:
die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen
ist mit unserer Liebe für immer von uns gegangen.
Jean Phillippe Rameau
Suite für Orchester aus der Oper „Les Boréades“


„Der unsterbliche Rameau ist das größte musikalische Genie, das Frankreich hervorgebracht hat.“
Camille Saint-Säens


Boreas, der mythologische Herr der kalten Nordwinde, hat Jean-Philippe Rameau den Namen und die Protagonisten seiner letzten Oper geliehen. Im Sturm erobern sie kraft ihrer überwältigenden Musik heute Abend den Konzertsaal und reißen gewiss auch das Berliner Publikum mit sich fort.
Im Land von Bach und Händel kennt man noch Corelli und Vivaldi, zumal um die Weihnachtszeit. Von deren französischen Zeitgenossen Couperin und Rameau wissen viele deutsche Musikfreunde nur vom Hörensagen. Dabei gehören die nicht minder als die oben genannten zu den größten Barockmeistern, welche die Musikgeschichte hervorgebracht hat.
Rameau, zwei Jahre älter als Bach und Händel, tätig am Hof von Ludwig XV, hat ein überaus schillerndes, repräsentatives Lebenswerk hinterlassen, das Kompositionen für Tasteninstrumente, Lieder, vor allem aber Opern und Ballette einschließt. Darüber hinaus hat er vielbeachtete musiktheoretische Traktate verfasst. Rameaus Sache ist es nie gewesen, sich politisch korrekt zu benehmen und vornehme Zurückzuhaltung zu üben. Mit Vehemenz hat er seine sowohl klassisch-konservativen als auch modern-innovativen Positionen vertreten und nicht gezögert, in die hitzigen Debatten darüber immer wieder selbst einzugreifen. Das zeitgenössische Publikum liebte und hasste ihn dafür gleichermaßen. Erhaben widerstand er den Niederungen all der Egogefechte und Hofintrigen, allein mit der Energie seines stupenden musikalischen Könnens.
Vom Ausmalen der Leidenschaften
Schon in seinen Cembalowerken findet sich das „peindre les passions“, das Ausmalen der Leidenschaften, das ihm in den Opern, die er als Gattung erst in der zweiten Hälfte seines langen Musikerlebens überhaupt für sich entdeckt hat, so recht zur zweiten Natur geworden ist. Die 1726/1727 entstandenen „Nouvelles suites de pièces de clavecin“ klingen kraft ihres schier überbordenden musikalischen Ausdrucks bereits wie imaginäre Opernszenen. Die Möglichkeiten des Cembalos werden völlig ausgereizt, wenn nicht sogar gesprengt. Umso erstaunlicher ist es, dass Rameau jenes Instrument, was er von Amts wegen viele Jahre gespielt hat, gar nicht mit Kompositionen bedacht hat: die Orgel. Dabei wären die reichen Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel ein dankbares Feld für den effektbewussten Musiker gewesen. Möglicherweise hat ihn der liturgische Zusammenhang eingeschränkt, in welchem die Orgel ihre Dienste zu leisten hat. Immerhin musste auch Bach nicht selten um die Akzeptanz seiner bisweilen spektakulär liturgiesprengenden Orgelmusik kämpfen.
50 Jahre alt war Rameau, als es ihm endlich gelang, als Opernkomponist Fuß zu fassen. Noch fast drei Jahrzehnte prägte er diese französische Gattung par excellence. Namentlich an den Maßstäben, die Jean-Baptiste Lully seit den 1670er-Jahren gesetzt hatte, rieb sich Rameaus Eigensinn. Die Uraufführung der ersten großen Oper, der Tragédie lyrique „Hippolyte et Aricie“, im Herbst 1733, geriet zu einem ästhetischen „Choc“. Anstatt gemessen und elegant wie Lully, formte Rameau seine Arien und Rezitative radikal im Dienste der Aussage, unterstützte dies noch mit einer farben- und kontrastreichen Instrumentierung und einer reichen, auch Dissonanzen nicht scheuenden harmonischen Sprache. Ein weiteres Gebiet, auf dem Rameau für Furore sorgte, war das in Frankreich sehr beliebte Ballett. Neben seinen fünf großformatigen Opern nahmen sechs abendfüllende Opéra-ballets und weitere kleinere Werke die Herzen des Publikums für ihn ein.
Die Boreaden kommen
In der Oper „Les Boréades“ nehmen Tänze und Instrumentalsätze etwa ein Viertel der Gesamtspieldauer von drei Stunden ein. Rameau erkannte sofort, dass er die instrumentalen Teile der Opern und Ballette in Suiten für Konzertzwecke zweitverwerten konnte.


In der Druckausgabe der Suiten aus seiner Oper „Les Indes galantes“ schrieb er 1735 im Vorwort, dass dem Publikum die Orchesterpassagen viel mehr zu gefallen schienen als die ganze Oper.
Für „Les Boréades“ indes konnte er keine Suiten mehr auskoppeln, ja er hat die Oper nie in einer vollständigen Aufführung gehört. Sie wurde 1763 zum Schwanengesang des fast 80-Jährigen. Nur einige Proben, dann kam die Absage der Premiere aus nicht geklärten Gründen. Ein Jahr danach ist Jean-Philippe Rameau gestorben. Auf diese Weise wurden „Les Boréades“ erst mehr als 200 Jahre später, 1975 konzertant und 1982 szenisch, unter der Leitung von John Eliot Gardiner uraufgeführt. Inzwischen aber erfreut sich die Oper enormen Zuspruchs. Dirigenten wie Roger Norrington, Simon Rattle, William Christie, Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm oder Václav Luks haben sie im Studio und auf europäischen Opernbühnen vielfach zum Klingen gebracht.
Heute Abend ist Gelegenheit, sich von der überwältigenden Schönheit der letzten kompositorischen Meisterleistung des fast 80-jährigen Rameau im Konzertsaal zu überzeugen. Ob Alphise, Königin von Baktrien, ihren Geliebten Abaris am Ende bekommt? Oder doch einen der Nachkommen des Nordwindes Borée nehmen muss? Der zornige Windgott hat die Aufmüpfige in sein unterirdisches Reich entführt. Aber Alphise hat starke Verbündete: Polymnie, die Muse des Gesanges, und Apollon, den Gott des Lichtes. Letzterer wendet die Sache zum Guten, indem er Abaris als seinen Sohn identifiziert, den er einst mit einer Nymphe gezeugt hatte, die ihrerseits eine Tochter des Boreas war.
Barocker Orchesterzauber
Wenn in der aufgewühlten Musik peitschende Winde und grelle Blitze zu hören sind, nutzt man dafür heute schon mal Donnerbleche, eine große Trommel und eine Windmaschine. Diese Orchesterinstrumente kennen wir von Richard Strauss. Aber gab es sie bereits bei Rameau? Da seine Überlegungen zu Fragen der Orchestrierung und zu vielen anderen Details, die er normalerweise erst im Laufe der Proben vorgenommen hätte, nicht mehr stattgefunden haben, müssen heutige Interpreten und Herausgeber bei der Aufführung von „Les Boréades“ viele Entscheidungen selber treffen.


Immerhin wissen wir, dass Rameau sehr früh Klarinetten im Orchester verwendete, beispielsweise um sie gemeinsam mit den unvermeidlichen Hörnern gleich zu Beginn in der Ouvertüre eine veritable Jagdszene schmettern zu lassen. Das weithin bekannte Rameau‘sche Jagd-Idiom aus Klarinetten und Hörnern wurde im 18. und 19. Jahrhundert gern kopiert.
In der Ouvertüre und in der stürmischen Zwischenaktmusik der Winde haben die rauschenden Tonleitern der Streicher eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen Kapriolen, die Vivaldi 1725 in den Concerti „Vier Jahreszeiten“ vorgelegt hat. Neben den brausenden Sturmmusiken kokettiert der leichte Westwind, der Zephyr, dargestellt von Piccoloflöten, nicht minder mit den Errungenschaften, die zuerst von Vivaldi bekannt geworden sind. Die vier „Jahreszeiten“-Konzerte wurden seit 1728 oft in Paris aufgeführt und in einer Pariser Ausgabe gedruckt. Rameau wird sich nicht gescheut haben – ebenso wenig wie nördlich der Alpen Bach –, dem italienischen Kollegen seine bewundernde Referenz zu erweisen. Auch wenn in Frankreich die italienische Musik als künstlerisch grob und politisch verdächtig galt, entzog sich kein Komponist von Rang dem künstlerischen Einfluss anderer Großer, in Paris im 18. Jahrhundert zum Beispiel Vivaldi, im 19. Jahrhundert dann Wagner.
Anton Bruckner
Sinfonie d-Moll WAB 100 (anullierte Sinfonie Nr. 2)


Bruckners gewaltige Null
Ablehnung seiner Werke bis zur totalen Erniedrigung durch Dirigenten, Orchester, Publikum, Presse auf der einen Seite, Verzückung und emotionale Aufschaukelung bis zur Extase auf der anderen vermögen die ungerechten Bewertungen nicht wirklich auszugleichen, sondern ersetzen sie durch neue, nicht minder ungerechte.


Ungerecht meint hier vor allem selbstgerecht und unrichtig. Unrichtig, weil nahezu die gesamte Bruckner-Rezeption schon zu Lebzeiten des Komponisten und erst recht nach seinem Tode auf nachgeschwatzten Klischees und Pauschalurteilen aufbaute. Kaum jemand – Mathias Hansen ist eine rühmliche Ausnahme, auch wenn er im Fall der sogenannten Nullten allzu forsch urteilt – hat sich die Mühe gemacht, die Substanz wirklich zu erforschen und neu zu befragen. Und selbstgerecht, weil Bruckner nicht wirklich beizukommen ist mit den Ellen der Logik und der Vernunft.
Zugegeben: Die Widersprüche liegen in Bruckner selbst. Mit einem Teil seiner Person verkörpert er durchaus die strenge wissenschaftliche Lehre von der Komposition. Zeitlebens bemüht er sich um Lehrämter, damit er den strengen Kontrapunkt unterrichten kann, ein kunstvolles Handwerk, das er außerordentlich gut beherrscht, ohne es je offiziell studiert zu haben. Seine Musik hingegen schöpft ihre Faszination mitnichten aus dieser Quelle. Die unbestreitbare Genialität hat ihre Ursachen ganz woanders. Vielleicht wäre sie sonst gut gemachte, gepflegte Belanglosigkeit. Nein, Bruckner hat es nicht gut gemacht im Sinne seines eigenen Handwerks. Er hat Grenzen gesprengt, Regeln missachtet, Tabus ignoriert. Gehandelt mit der atemberaubenden Selbstverständlichkeit eines starken Charakters, ohne kalkulierende Berechnung, ohne intellektuelle Reflexion, ohne die Skrupel der Vernunft. Das macht diesen ungehobelten Klotz mit übersprudelnder Seele ebenso anziehend wie abstoßend – und manchmal beides zusammen.
Keine Angst vor dem Riesen
1824, in Bruckners Geburtsjahr, hatte es eine abgrundtiefe Zäsur in der Entwicklung der Sinfonie gegeben: „Die jüngste Sinfonie, die für Bruckner zählte – zugleich die für ihn wichtigste, Beethovens Neunte –, lag vierzig Jahre zurück, da er an seiner ersten schrieb. Aber der in jedem anderen Lebensbereich ängstlich Absichernde findet es gar überflüssig, wie seine großen Vorgänger oder neben ihm Brahms, sich den ‚Weg zur großen Sinfonie’ auf Umwegen zu bahnen, etwa über die Komposition von Sonaten oder Kammermusik. Er springt in die Aufgabe hinein... Aus der Geborgenheit der Kirche und des durch sie verbürgten Komponierens tritt er hinaus auf ein freies Feld und stellt sich in der Sinfonie dem denkbar höchsten Anspruch, zugleich einem außerhalb jener Institution gelegenen, die ihn für ihre Dienste so perfekt zugerichtet hat. Dieses Paradoxon voll zu verstehen, hieße fast den ganzen Bruckner zu verstehen.“ (Peter Gülke)
Bis zur schöpferischen Lähmung fürchteten im 19. Jahrhundert die Tonsetzer die Nachwirkung der Leistung Beethovens. Zu deren verbaler Glorifizierung hatte Richard Wagner recht eigennützig allerhand beigetragen. Das goldene Zeitalter der Gattung Sinfonie galt als beendet. Kein gewichtiger Komponist österreichisch-deutscher Geburt schien mehr bereit, das Erbe Beethovens, Schuberts, Schumanns anzutreten – unmöglich war es, an eine Musiktradition anzuknüpfen, in der vermeintlich alles gesagt worden war. Wagner erklärte die Sinfonie für tot, sah sie abgelöst von der „Sinfonischen Dichtung“ Lisztscher Prägung und von seinen eigenen Ideen des „Musikdramas“.
Anton Bruckner, der weltfremde Einzelgänger, wagte das Unmögliche und errichtete in seinen sinfonischen Werken eine neue Welt in tätiger Auseinandersetzung mit klassischer Tradition wie mit neuromantischem Zeitgeist. Unbändig – will heißen ungebunden, auch nicht zu bändigen – in Phantasie und Schaffenskraft, wandelte Bruckner auf ebenso steinigen wie unzeitgemäßen Pfaden. Während Brahms‘ Erste zu ihrem Verständnis zwei Jahrhunderte Musikgeschichte voraussetzte, schien Bruckner unter der Last der Tradition nicht zu leiden. Fast naiv, und dennoch höchst selbstkritisch ging er zu Werke.
Null und nichtig? Mitnichten!


Die „Null“ auf dem Titelblatt der d-Moll-Sinfonie ist in Wahrheit eine durchgestrichene Null, demnach keine Ordnungszahl, sondern ein Tilgungszeichen. Überdies trug das Werk, bevor Bruckner es wahrscheinlich 1872 (nach Abschluss der Zweiten) annullierte, die Bezeichnung „Sinf.No.2“. Somit wäre die d-Moll-Sinfonie die „annullierte zweite Sinfonie“ (während analog die f-Moll-„Studiensinfonie“ von 1863/64 – die einzige noch nicht wirklich originelle und typische Sinfonie Bruckners – als „annullierte erste Sinfonie“ angesehen werden kann).
Die „Nullte“ ist also in Wirklichkeit bereits Bruckners dritte Auseinandersetzung mit der sinfonischen Gattung. Warum hat Bruckner sie für ungültig erklärt? Fraglos wird dabei die so ehrlich gemeinte wie kränkende Reaktion des Wiener Hofopernkapellmeisters Felix Otto Dessoff eine Rolle gespielt haben, der nach Durchsicht des ersten Satzes der Sinfonie erstaunt die Augenbrauen gehoben haben soll: „Ja, wo ist denn das Thema?“ Dessoff berührte mit der Frage ein Strukturmerkmal, das Bruckner möglicherweise gar nicht bewusst war, das aber seine sinfonischen Gebäude im Gegensatz zu allen herkömmlichen Bauprinzipien der Gattung von Grund auf prägen sollte: das Miteinander von blockhafter Architektur und permanentem Fluss, bei gleichzeitiger Vermeidung von Themendualismus und dialektischer Entwicklung. Bruckner war weder ein begnadeter Melodiker noch ein raffinierter Harmoniker, am ehesten war er ein durchtriebener Rhythmiker und ein auf der Orgel geschulter schöpferisch Suchender. Vor allem – und vor allen anderen – war Bruckner jedoch ein Meister des immerwährenden Überganges! Weder mit Schumann oder Wagner, noch mit Liszt oder Brahms und auch nicht mit Mahler zu vergleichen, errichtete er aus kleinsten, vielfach hin und her gewendeten Motivbausteinen wahre Klangkathedralen, stabil, monumental, strukturreich, bisweilen wohltuend klar und immer auch ruhevoll.
Das alles gilt in bisher grob unterschätztem Maße auch für die ominöse „Nullte“. Ihre vermeintliche Unzulänglichkeit birgt nichts weniger als den Keim Brucknerschen Komponierens schlechthin, vielleicht in der Handhabung der Mittel noch mit einiger Ungeschicklichkeit behaftet. Der Musikforscher Wolfram Steinbeck nannte 1990 die d-Moll-Sinfonie von 1869 die „nullte Fassung“ der 1873 datierten ersten Fassung der Sinfonie Nr. 3. Tatsächlich hat Bruckner zeit seines Lebens an mehreren Sinfonien parallel gearbeitet, stets um das Ideal bemüht, jedoch bisweilen ein Werk durch fremde Einflüsterungen und fortwährende Änderungen abschwächend und verschlimmbessernd. Im Fall der d-Moll-Sinfonie lief es anders: Statt an der „Nullten“ immer wieder herumzuwerkeln, nahm Bruckner manche ihrer Ideen auf, um sie in einem neuen Versuch, nämlich in der später offiziellen Sinfonie Nr. 3 (ebenfalls in d-Moll!), in eine neue Richtung zu lenken.


Gleichwohl darf die Sinfonie von 1869 als zusätzliches Zeugnis für Bruckners neue kompositorische Wege gelten. An dieser Stelle soll ausdrücklich keine vergleichende Beschreibung der Details der Sinfonie folgen, vielmehr eine Einladung zum unvoreingenommenen Hören!
Alle Sinfonien Bruckners, inklusive ihrer unablässigen Überarbeitungen, muten wie ein einziger großer Versuch des Komponisten an, das Phänomen Sinfonie für sich schlüssig zu fassen und damit den hohen Auftrag zu erfüllen, der für ihn darin bestand, das immerwährende musikalische Kontinuum des Universums in markanten Manifestationen für die Menschen direkt erlebbar zu machen. Für die daraus folgende vermeintliche stilistische Einseitigkeit des Sinfonikers Bruckner schlägt sein späterer Kollege Karl Amadeus Hartmann einen überraschenden Zugang vor: „... denn es ging ihm wohl weniger um neun verschiedene Charaktere als um einen solchen, und zwar denjenigen, der die Sinfonie der Epoche vertrat... Er produzierte mit einem Einschlag jener meisterlichen Ergriffenheit, mit der die Bauleute des Mittelalters ihre Kirchen errichteten, denen sich auch leicht eine gewisse überpersönliche Gleichförmigkeit nachsagen lässt.“
Die Uraufführung der frühen d-Moll-Sinfonie fand am 12. Oktober 1924 unter der Leitung von Franz Moißl in Klosterneuburg statt, nachdem ein halbes Jahr zuvor bereits das Scherzo und das Finale öffentlich erklungen waren. In jedem Falle sollte für das Werk der Begriff „Nullte“ vermieden werden, der, obschon er griffig klingt, einen falschen Rang der Sinfonie suggeriert.
© Steffen Georgi
Kurzbiographien
Marc Minkowski

Marc Minkowski spielt sowohl in seiner spannenden Karriere als Dirigent als auch als künstlerischer Leiter eine aktive Rolle bei der Förderung der klassischen Musik. Als künstlerischer Leiter der von ihm 1982 gegründeten Les Musiciens du Louvre rief er 2011 das Ré Majeure Festival auf der Île de Ré (französische Atlantikküste) ins Leben. Von 2016 bis 2021 Generaldirektor der Opéra National de Bordeaux, künstlerischer Leiter der Mozartwoche ( Mozartwoche) in Salzburg von 2013 bis 2017, von 2018 bis 2022 war er künstlerischer Berater des Kanazawa Orchestra (Japan). Im Jahr 2018 wurde er als Chevalier de la Légion d’Honneur geehrt.
Nach seinem Studium des Fagotts begann Marc Minkowski schon in jungen Jahren mit dem Dirigieren und besuchte dann die Akademie von Maestro Charles Bruck an der Pierre Monteux Memorial School in Hancock, Maine. Im Alter von neunzehn Jahren gründete er Les Musiciens du Louvre, ein Ensemble, das eine aktive Rolle bei der Wiederbelebung der Barockmusik spielen sollte. Unter seiner Leitung erkundeten Les Musiciens du Louvre sowohl französische Barockmusik als auch Händel, bevor sie ihr Repertoire um Mozart, Rossini, Offenbach, Bizet und Wagner erweiterten.
Florian Sempey

Der Bariton Florian Sempey ist einer der gefragtesten Lyriker der internationalen Szene.
Seine stürmische Karriere führte ihn bereits dazu, in der Titelrolle von Il Barbiere di Siviglia auf Bühnen auf der ganzen Welt aufzutreten, darunter an der Opéra de Paris, dem Royal Opera House, der Opera di Roma, dem New National Theatre in Tokio und dem Théâtre des Champs-Élysées und viele andere. Im Konzert ist Florian neben den Wiener Symphonikern, den Berliner Philharmonikern und dem Orchestre National de France zu hören und besucht internationale Bühnen mit Aufführungen von Händels Apollo e Dafne bis zu Mahlers Liedern Eines fahrenden Gesellen. Florian studierte Klavier und Gesang am Konservatorium in Libourne. Anschließend studierte er Gesang am Konservatorium von Bordeaux. Im Jahr 2007 trat Florian in die Klasse von Maryse Castets am Konservatorium von Bordeaux ein. Im folgenden Jahr gewann er den ersten Opernpreis und den Publikumspreis beim Gesangswettbewerb des Amis du Grand Théâtre der Oper Bordeaux. Im Alter von 21 Jahren debütierte er in der Rolle des Papageno an der Oper von Bordeaux und gastiert dort seitdem regelmäßig. 2010 begann er eine zweijährige Tätigkeit im Atelier Lyrique der Pariser Oper und 2012 erhielt der Bariton den hochgeschätzten Prix Carpeaux. Im Jahr 2013 wurde Florian in der Kategorie „Revelation Opera Singer“ bei den Victoires de la Musique Classique nominiert.


RSB-Abendbesetzung
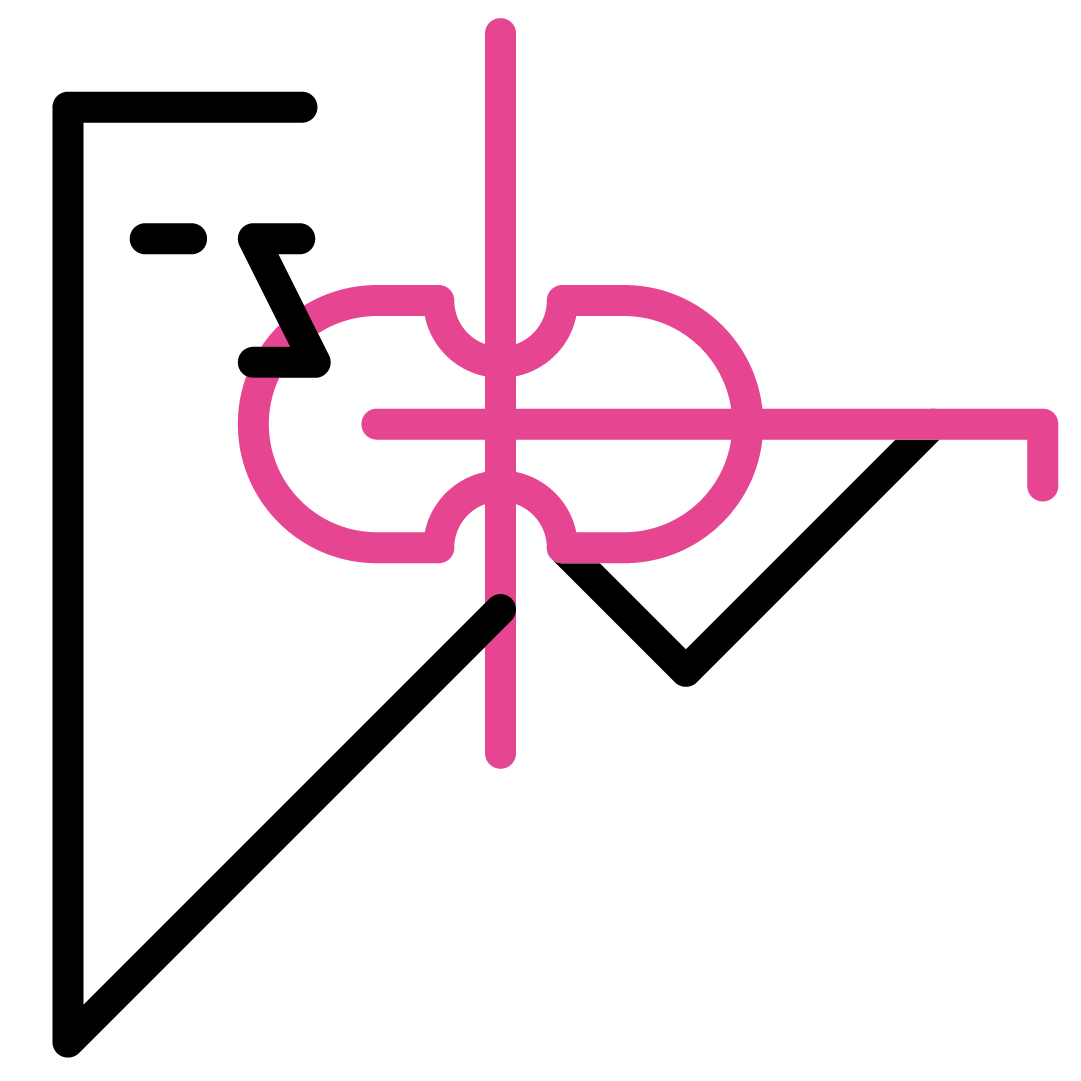
Violine 1
Ofer, Erez
Nebel, David
Herzog, Susanne
Yoshikawa, Kosuke
Bondas, Marina
Beckert, Philipp
Kynast, Karin
Tast, Steffen
Morgunowa, Anna
Feltz, Anne
Polle, Richard
Oleseiuk, Oleksandr
Behrens, Susanne
Cazak, Cristina
Marquard, David
Ries, Ferdinand
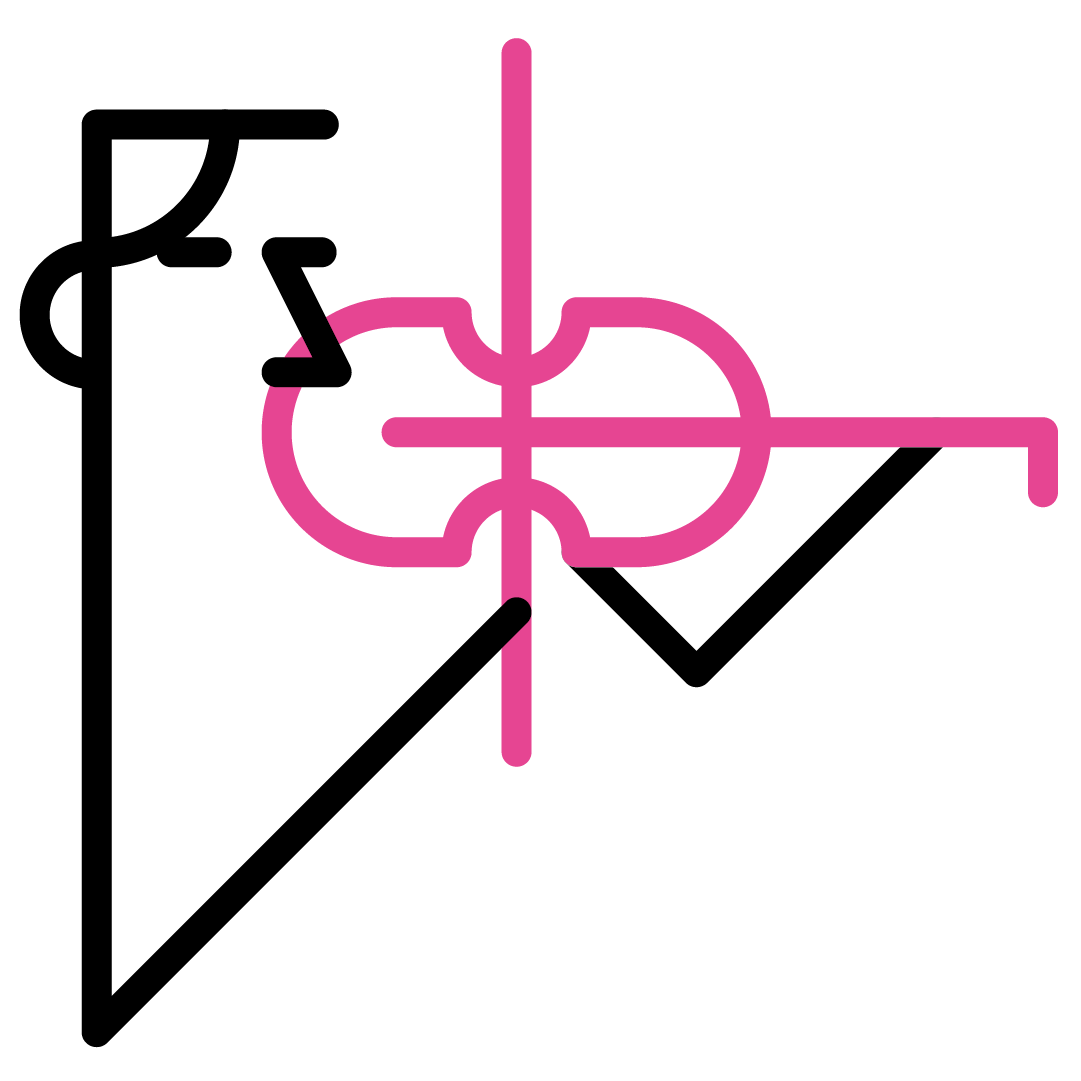
Violine 2
Kurochkin, Oleh
Drop, David
Petzold, Sylvia
Seidel, Anne-Kathrin
Draganov, Brigitte
Eßmann, Martin
Buczkowski, Maciej
Manyak, Juliane
Hetzel de Fonseka, Neela
Bauza, Rodrigo
Palascino, Enrico
Leung, Jonathan
Kanayama, Ellie
Vatseba, Vasyl

Viola
Rinecker, Lydia
Adrion, Gernot
Silber, Christiane
Zolotova, Elizaveta
Markowski, Emilia
Drop, Jana
Doubovikov, Alexey
Montes, Carolina
Nell, Lucia
Inoue, Yugo
Yoo, Hyelim
Roske, Martha

Violoncello
Eschenburg, Hans-Jakob
Riemke, Ringela
Weiche, Volkmar
Albrecht, Peter
Boge, Georg
Breuninger, Jörg
Weigle, Andreas
Kalvelage, Anna
Fijiwara, Hideaki
Ricard, Constance
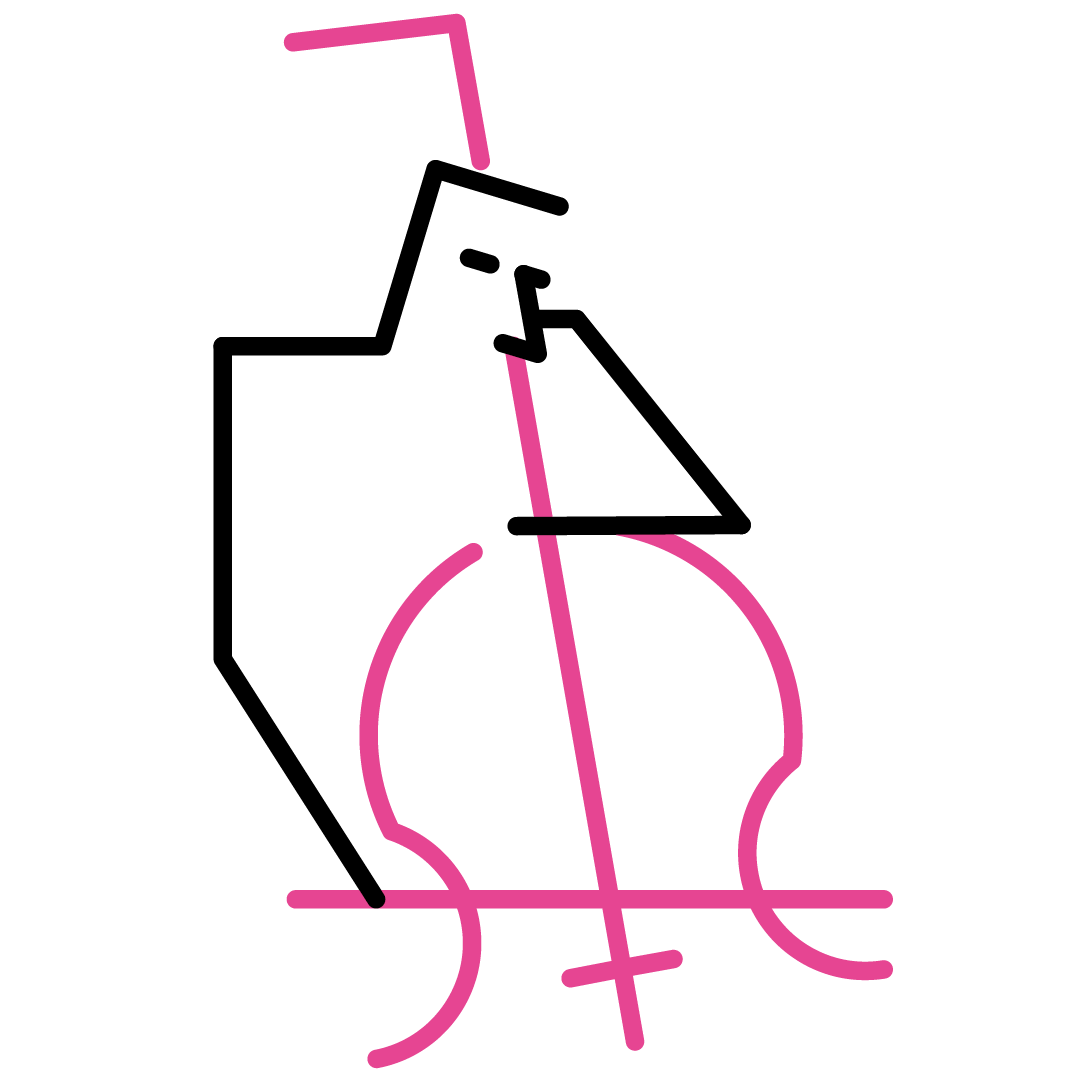
Kontrabass
Wömmel-Stützer, Hermann
Figueiredo, Pedro
Rau, Stefanie
Schwärsky, Georg
Gazale, Nhassim
Thüer, Milan
Moon, Junha
Schlootz, Julian
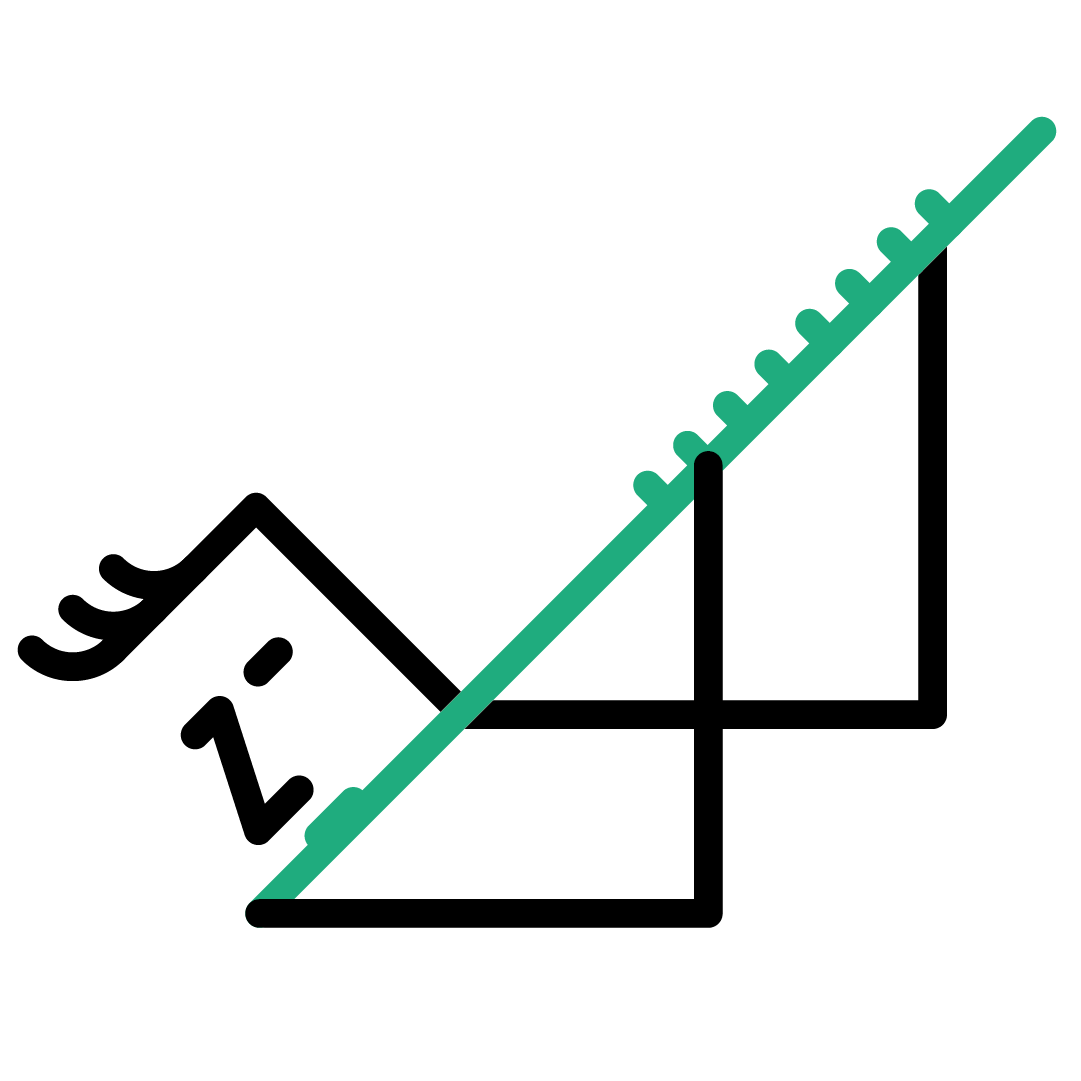
Flöte
Bogner, Magdalena
Döbler, Rudolf
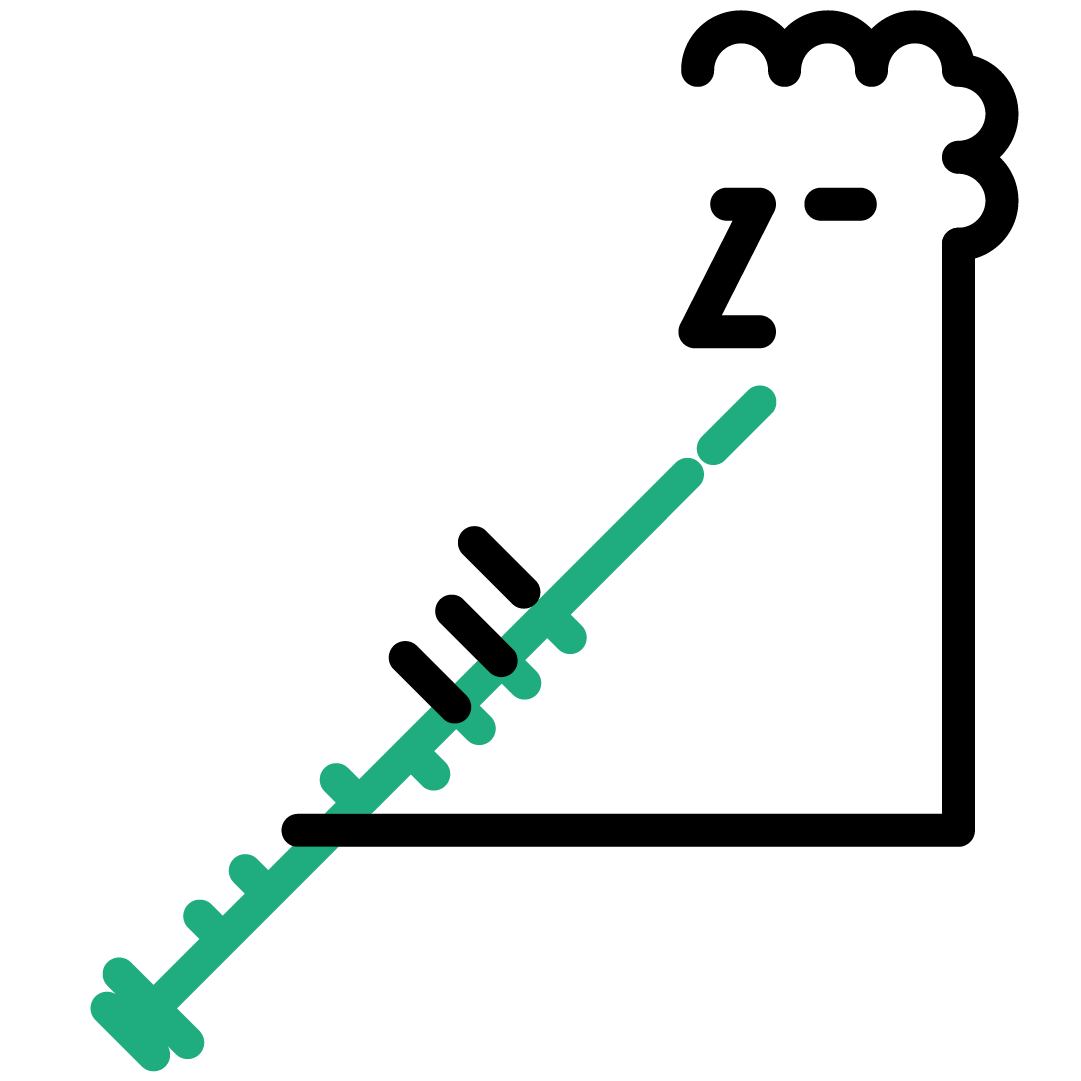
Oboe
Shore, Nigel
Vogler, Gudrun
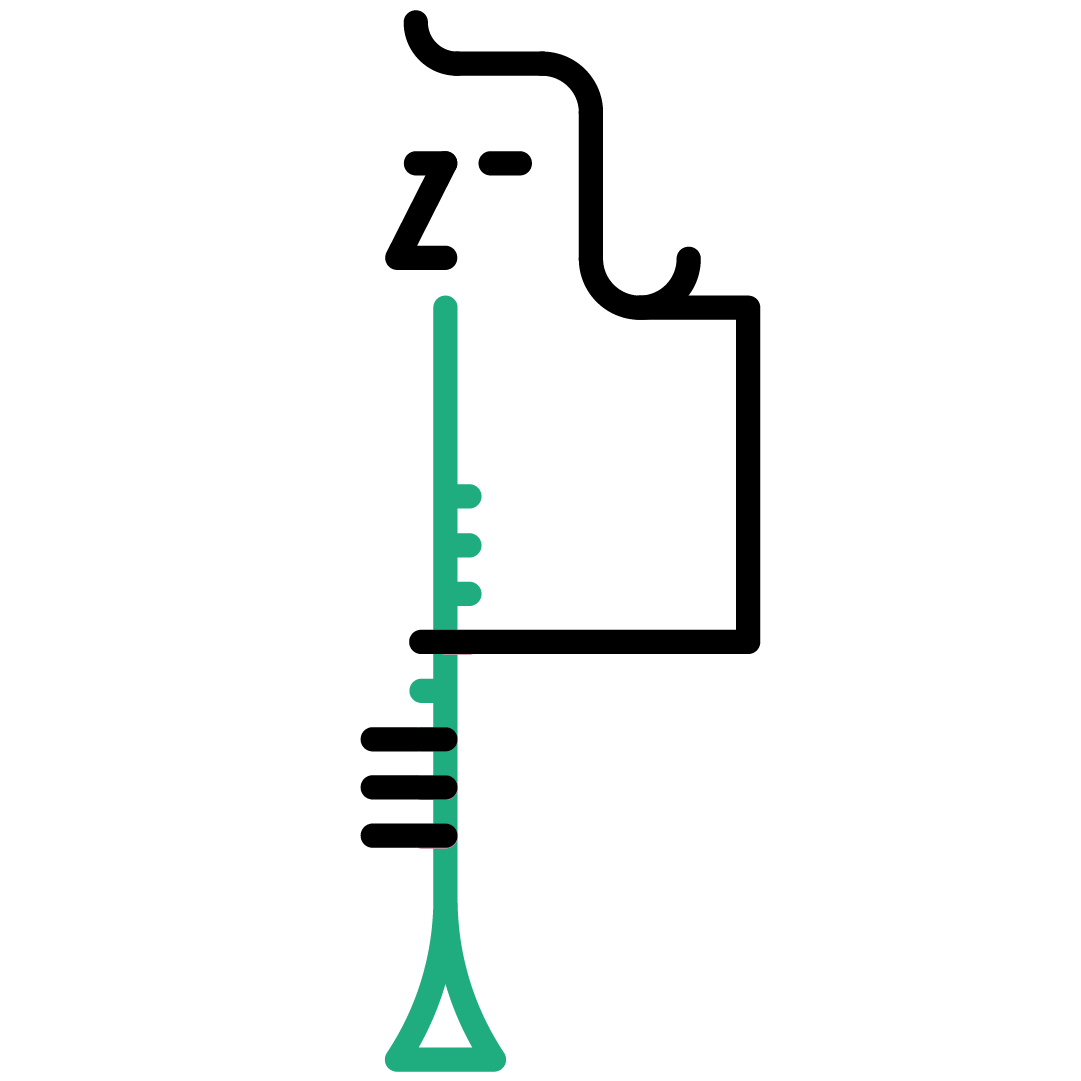
Klarinette
Link, Oliver
Pfeifer, Peter
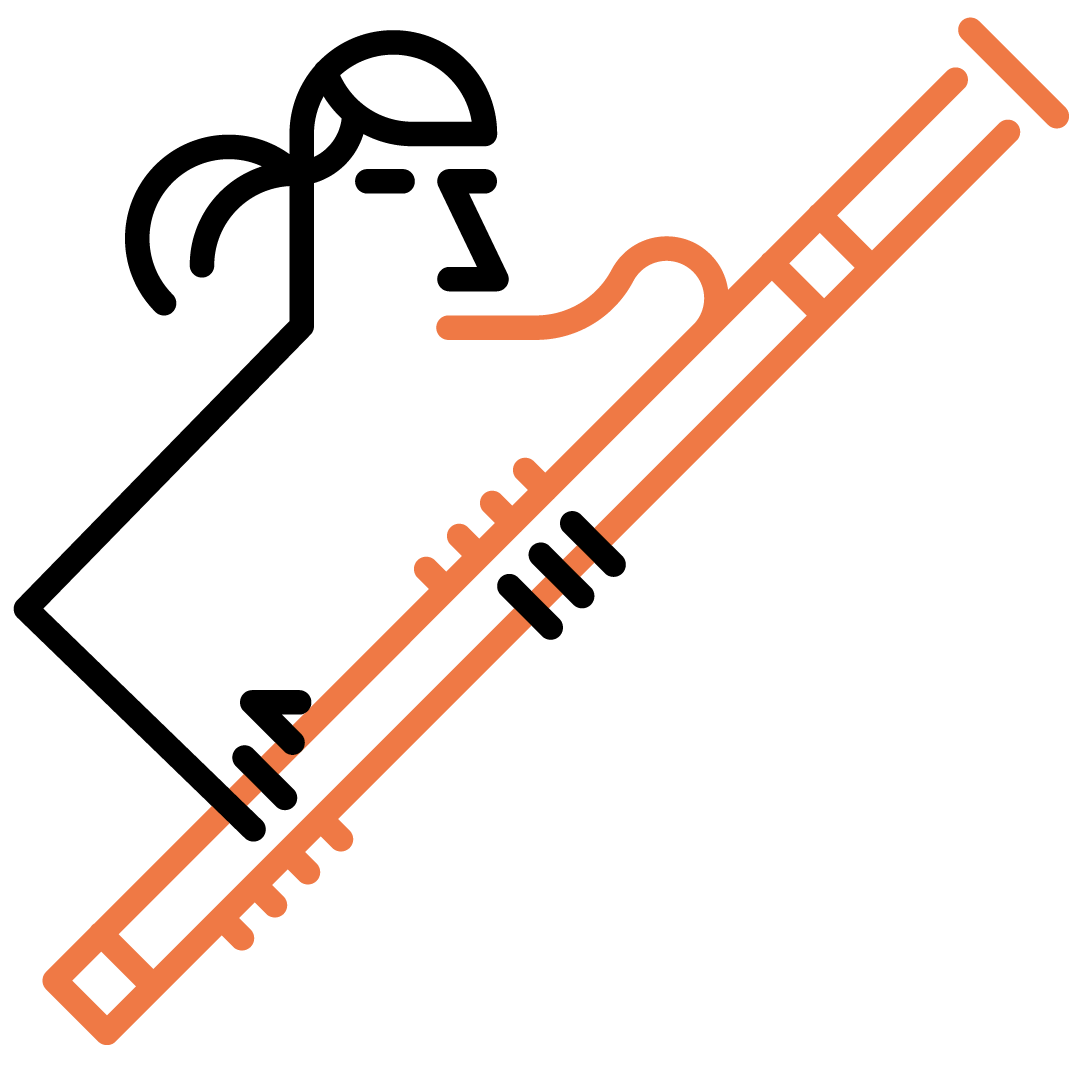
Fagott
Kofler, Miriam
Voigt, Alexander
Königstedt, Clemens
Gkesios, Thomas

Horn
Ember, Daniel
Klinkhammer, Ingo
Stephan, Frank
Hetzel de Fonseka, Felix

Trompete
Dörpholz, Florian
Niemand, Jörg

Posaune
Hölzl, Hannes
Vörös, József
Lehmann, Jörg

Harfe
Edenwald, Maud

Schlagzeug
Tackmann, Frank
Thiersch, Konstantin
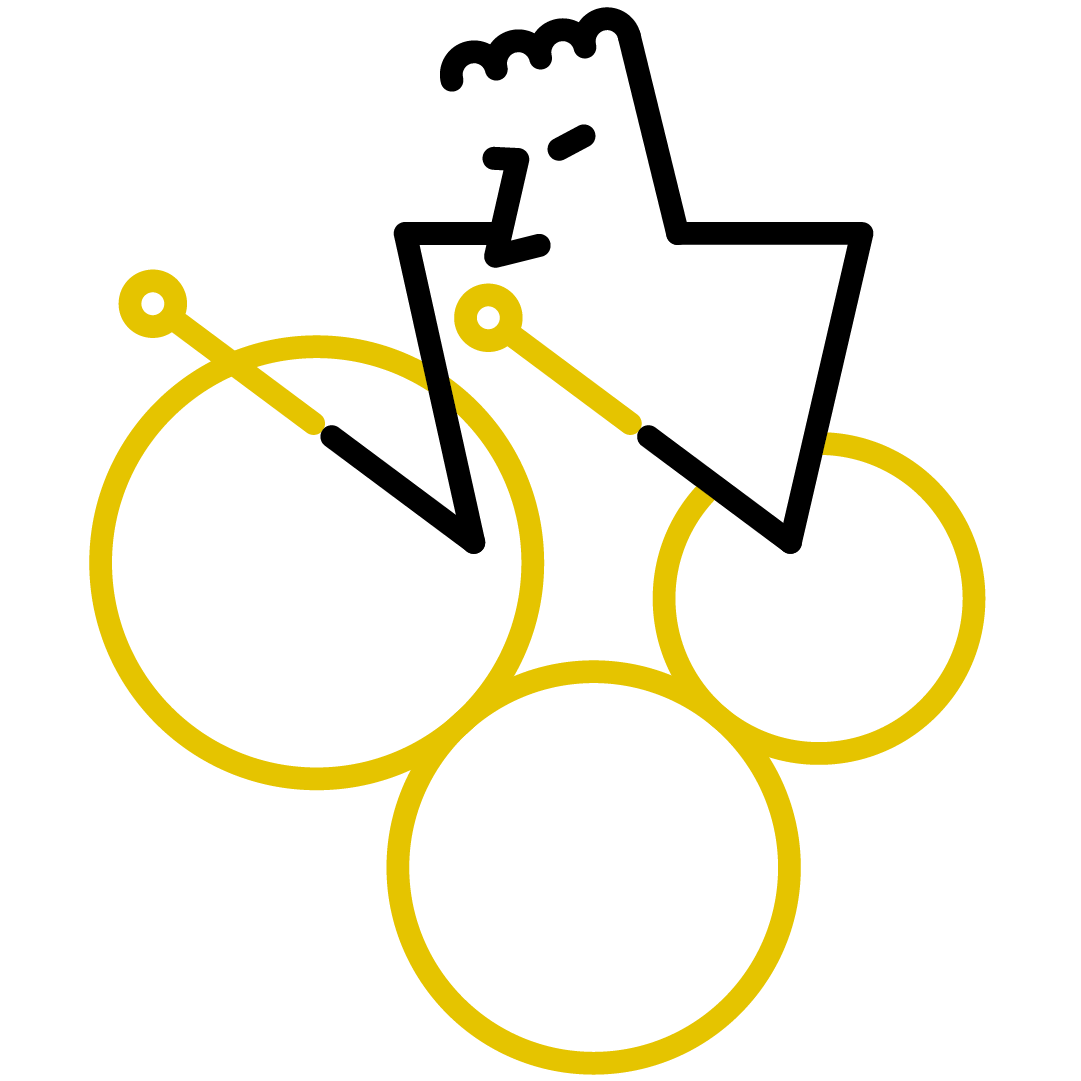
Pauke
Eschenburg, Jakob
Cembalo
Schneider, Arno
Kooperation

Bildrechte
Portrait Marc Minkowski © Benjmin Chelly
Portraits Florian Sempey © Eduoard Brane
Fotos Orchester und Probe © Peter Meisel und Josina Herrmann