

Digitales Programm
So 14.01. Andrés Orozco-Estrada
20:00 Philharmonie
Antonín Dvořák
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 h-Moll op. 104
Pause
Richard Strauss
„Don Juan“ – Tondichtung op. 20
Suite aus der Oper „Der Rosenkavalier“
Besetzung
Andrés Orozco-Estrada, Dirigent
Julia Hagen, Violoncello
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Das Konzert wird am 01.02.2024 um 20.03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur übertragen.
Konzerteinführung: 19.10 Uhr, im Südfoyer von Helge Grünewald.
„Muss es sein?“ - Der Konzertpodcast des RSB
Antonín Dvořák
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 h-Moll op. 104


„Obzwar ich genug in der großen Welt
Antonín Dvořák
herumgekommen bin, bleibe ich doch nur, was ich bin – ein schlichter tschechischer Musikant.“
1925 aufgefunden, wird es heute gelegentlich gespielt, an Popularität kann es mit dem 30 Jahre späteren h-Moll-Konzert bei weitem nicht konkurrieren. Obwohl Antonín Dvořák kein einziges Werk komponiert hat, wo die Bratsche solistisch dominiert, zeichnen sich viele seiner Kompositionen, nicht zuletzt die beiden Cellokonzerte und zahlreiche Kammermusik, durch jenen warmen Klang in der Mittellage aus, der auch die Musik von Dvořáks Mentor Johannes Brahms so attraktiv macht. Ein Bratscher zu sein, ist kein gewöhnlicher Beruf, sondern eine Lebenshaltung.
Einem echten Bratscher sind eitler Ehrgeiz, virtuose Äußerlichkeit wesensfremd. Und auch wenn Dvořák später ein gefeierter Komponist wurde, amerikaerfahren und weltoffen, blieb er im Grunde seines Herzens ein Bratscher – und ein Tscheche.
Berühmt und einsam
Die Karriere begann für Dvořák mit einem Stipendium für mittellose talentierte Musiker, zu dem Johannes Brahms dem jungen Böhmen 1875 verhalf. Als Dirigent in der Heimat, in Deutschland und England (seit 1884) sowie als Lehrer am Prager Konservatorium erlangte er internationales Ansehen. Die Universitäten in Cambridge und Prag verliehen ihm 1891 die Ehrendoktorwürde. Jeanette M. Thurber, die Gründerin des National Conservatory in New York, berief ihn 1892 als Direktor ihres Institutes. Dvořák kam, nicht zuletzt wegen des 25-fachen Gehaltes, das ihm im Vergleich zu Prag hier geboten wurde. Dvořák begann das Konzert für Violoncello und Orchester im November 1894 in New York, nachdem er aus den Sommerferien zurückgekehrt war, die er zu Hause im böhmischen Vysoká verbracht hatte.

Antonín Dvořák an Josef Boleška, Januar 1895
„Nun beende ich bereits das Finale des Cellokonzertes. Könnte ich so sorglos arbeiten wie in Vysoká, wäre ich schon längst fertig. … das beste wäre, in Vysoká zu sein – dort lebe ich wieder auf, ruhe aus und bin glücklich. Wäre ich doch wieder dort!“
Seine Sehnsucht nach der Heimat stieg ins Unermessliche, so dass er im April 1895 den Amerikaaufenthalt vorzeitig abbrach, um nach Prag zu reisen. Glanz und Glamour der Neuen Welt waren ihm so reichlich wie keinem anderen europäischen Komponisten seiner Generation zuteilgeworden, in Amerika gehalten haben sie ihn nicht.
Lasst mich allein in meinen Träumen
Enge biographische und musikalische Zusammenhänge legen offen, wie sehr Dvořák während der Arbeit gerade am Violoncello-Konzert in Gedanken zu Hause weilte. Da wäre Josefina Čermáková (1849-1895) zu erwähnen. Als junger Tutti-Bratscher hatte er die 16-jährige Sopranistin im Klavierspiel unterrichtet und betete sie leidenschaftlich an, seitdem sie seine Kollegin am Prager Interims-Theater geworden war. Doch die junge Dame erhörte ihn nicht, heiratete stattdessen den Grafen Václav Kounic. Dvořák seinerseits schloss 1873 die Ehe mit ihrer jüngeren Schwester Anna (1854-1931). Das erste Kind der Dvořáks hieß – Josefina. Im November 1894, zwei Jahrzehnte später, zitierte er im zweiten Satz, dem seelenvollen Mittelpunkt des Cellokonzertes, jenes Lied, das Josefina besonders geliebt hatte: „Lasst mich allein in meinen Träumen“.
Als die noch immer verehrte Schwägerin kurz nach Dvořáks Rückkehr in die Heimat im Mai 1895 verstarb, griff er entscheidend in das bereits fertiggestellte Cellokonzert ein: Er strich vier Takte kurz vor Schluss des Finales, um sie durch 60 neukomponierte zu ersetzen, die nochmals, nun unverhüllt, das Thema des erwähnten Liedes aufgreifen.
Welchen Rang diese Änderung für ihn besaß, bezeugt eine Auseinandersetzung mit dem Widmungsträger des Konzertes, Hanuš Wihan. Jener vortreffliche Cellist hatte – durchaus zeitüblich – selbst eine virtuose Kadenz verfasst, die er eben an dieser Stelle kurz vor Schluss wirkungsvoll einzufügen gedachte. Dvořák geriet darüber unerklärlich heftig in Harnisch, übertrug die Uraufführung am 19. März 1896 in London und auch die nächste am 11. April in Prag einem anderen Cellisten, dem Engländer Leo Stern. Und Fritz Simrock, den befreundeten Verleger, wies er am 3. Oktober 1896 brieflich an: „Überhaupt es muss in der Gestalt sein, wie ich es gefühlt und gedacht habe… Das Finale schließt allmählich diminuendo – wie ein Hauch – Reminiszenzen an den ersten und zweiten Satz – das Solo klingt aus bis zum pp – dann ein Anschwellen – und die letzten Takte übernimmt das Orchester und schließt in stürmischem Tone. Das war so meine Idee und von der kann ich nicht ablassen.




Klassisch, romantisch, zeitlos
Formal strikt an der Klassik orientiert, schnell – langsam – schnell, besitzt Dvořáks Werk überdies sinfonische Dimensionen. Das Soloinstrument ist bei allem technischen Anspruch eingebettet in den Orchesterklang. Das Orchester fungiert als gleichrangiger Partner, nicht als Klangteppich. Brahms, bewundernd:


„Warum habe ich nicht gewusst, dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann? Hätte ich es gewusst, hätte ich schon vor langer Zeit eines geschrieben!“
Mehrere Instrumente treten solistisch im Dialog mit dem Cello hervor. Alle Motive und Themen des Konzertes stammen unverkennbar von Dvořák. Man glaubt, das Anfangsthema der Sinfonie aus der Neuen Welt herauszuhören, man fühlt sich an manchen Slawischen Tanz erinnert, man findet den herzlichen Volkston, der in den Opern herrscht. Ist das das Geheimnis, das Dvořáks Musik klingen lässt, als sei sie anstatt mit kalter Tinte mit warmem Herzblut geschrieben worden?
Richard Strauss
„Don Juan“ – Tondichtung op. 20


„Hinaus und fort
Nikolaus Lenau, aus „Don Juan“
nach immer neuen Siegen,
Solang der Jugend
Feuerpulse fliegen!“
Das ist bis heute ein unzusammenhängendes Puzzle; ein lohnendes Forschungsprojekt wäre es allemal. Ausschweifend, nein, so lebte Strauss nicht. Keine stillen Anbetungen, keine wechselnden Beziehungen, keine käufliche Liebe, keine Skandale. Enttäuschend fast seine Geradlinigkeit, seine 55-jährige eheliche Treue, seine immerwährende Liebe zu Pauline de Ahna, zu seiner Frau. Hatte ihn die temperamentvolle, starke Frau tatsächlich zeitlebens mit dem „Stacheldraht ihrer Liebe“ umzäunt, wie Strauss einmal derb scherzte?
Erfüllung und Ekel


Die literarische Vorlage für Strauss‘ „Don Juan“ liefert Nikolaus Lenaus dramatisches Gedicht über den legendären Liebhaber, dem der Spanier Tirso de Molina als erster ein Drama, dem Christoph Willibald Gluck ein Ballett, Mozart und Dargomischsky große Opern gewidmet haben.
Wie Tannhäuser sucht Don Juan den ultimativen Kick beim Genuss der Liebe zur Frau an sich. (Lenau: „Ich fliehe Überdruß und Lustermattung, … Die einzlne kränkend, schwärm ich für die Gattung.“) Aber Don Juan geht dafür nicht in den Venusberg zur Göttin, sondern er widmet sich allein den irdischen Frauen. „Weil er dies taumelnd von der einen zur andern nicht findet, so ergreift ihn endlich der Ekel, und der ist der Teufel, der ihn holt.“ (Nikolaus Lenau) Die Szene hinter der Szene des „Don Juan“, aber auch hinter der des „Heldenlebens“, hinter „Tod und Verklärung“ und hinter all den anderen Strauss’schen Potenzprotzen, ist der schale Ekel. Nichts als feinen Spott hat Strauss übrig für die Siegertypen der Wilhelminischen Ära, denen Erfolge zur sportlichen Routine werden, bis sie ermatten und buchstäblich sang- und klanglos untergehen.
Die Last der Lust


Anfangs findet sich noch der selbstherrliche Held in der Partitur, der die Fülle des Lebens und der Liebe will. Unendlich groß fühlt er sich in seinem Verlangen nach absoluter Intensität gegenüber der kleinlich verklemmten Philistermoral seiner Umgebung.
Die Liebesszenen, atmosphärisch dicht, voller detailreicher Symbolik, vermögen sinnlich zu erregen in der von Tolstoi („Kreutzersonate“) verabscheuten Art und Weise. Solovioline und Klarinetten leihen der ersten Sequenz Substanz und Farbe, in der Begleitung zitiert Strauss „O sink hernieder, Nacht der Liebe“ aus Wagners „Tristan“. Noch erotischer wird’s im Mittelteil, wenn warmer Streicherschmelz und heller Flötenglanz sich zu betörender Oboenseligkeit verströmen. Es fehlt nicht der Maskenball, ein erregendes Prunkstück jeder guten romantischen Erzählung. Von Jean Paul bis Edgar Allan Poe gelten in der Literatur solche koketten Versteckspielereien als Schicksalsstunden, die entweder grandios oder fatal enden. Lenau und mit ihm Strauss springen auf die kalte, finstere Rückseite des prallen Lebens, auf den Friedhof. Don Juan verhöhnt den Komtur, eines seiner Opfer. Doch anders als in Mozarts Oper kommt der Tote nicht zum Gelage. Dafür erscheint sein Sohn mit vielen Frauen und Kindern, den Geliebten und Gezeugten Don Juans. Der Rivale befreit den Erotokraten schließlich vom Leben, dessen er längst überdrüssig geworden ist.
„Es war ein schöner Sturm,
Nikolaus Lenau, aus „Don Juan“
der mich getrieben,
Er hat vertobt
und Stille ist geblieben. …
Und plötzlich ward die Welt
mir wüst, umnachtet;
… der Brennstoff ist verzehrt,
Und kalt und dunkel
ward es auf dem Herd.“
Richard Strauss
Suite aus der Oper „Der Rosenkavalier“


Det is keene Musik für mich!


Richard Strauss’ und des Dichters Hugo von Hofmannsthals Werk spielt in den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts, den Wiener Walzer aber entlehnt Strauss dem 19. Jahrhundert. Gleichzeitig bedient er sich – darin ganz Jugendstil – der raffinierten Kompositionstechniken des frühen 20. Jahrhunderts.
Doch was bedeutet das angesichts der schmerzvollen Werke des Abschieds, die Gustav Mahler zur gleichen Zeit sich entringt, um verzweifelten Herzens „Leb wol“ zu sagen allem, was in der Kunst bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wert und heilig gewesen war?
Und was bedeutet es angesichts des spektakulären Aufbruchs der Moderne, für die Schönberg und Strawinsky anno 1910 schon in den Startlöchern sitzen? Mit Sturmglocken, Dissonanzen, Geklirr und Geschrei. Richard Strauss überflutet die Risse und Brüche, die sich allerorten auftun, mit herrlicher, süßer Musik. Darüber kann ein Strawinsky nur spotten: „Sklerosenkavalier“.
Strauss’ Figaro
Strauss hat sich in seiner letzten Aufzeichnung (19. Juni 1949) selbst einen „griechischen Germanen“ genannt. Das Olympia der Griechen, Hort der Harmonie von Volk, Kunst, Natur und Religion, so meint Strauss, ist von einer arkadischen Landschaft umgeben, Bayreuth dagegen, das „Olympia des Nordens“, von einer bedrohlichen und sorgenvollen Welt aus „Fabriken, Zuchthäuser(n) und Irrenhäuser(n)“.
Aus Komödien und Romanen Molieres, Goethes, Hogarths und de Mussets entwickelt Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) für seinen Komponisten ein „ganz frisches Szenar einer Spieloper“, die im Wien Maria Theresias spielt. Die Oper hat mit der Feldmarschallin Fürstin Werdenberg sogar eine Marie Theres als Hauptfigur. Die beiden anderen Protagonisten wetteifern um die Ehre des Titelhelden: Strauss hätte „Ochs auf Lerchenau“ als Operntitel vorgezogen. Schließlich setzt sich – auf Anraten von Pauline Strauss – „Der Rosenkavalier“
durch.
Der Mozart der Neuzeit
Richard Strauss, das Prinzip Gesundheit. Der Sohn des ersten Hornisten der Hofoper und der Bierbrauerstochter Josephine Pschorr, 1864 in München geboren, wohlbehütet in der Atmosphäre der alten süddeutschen Kunstmetropole aufgewachsen, von leichter Auffassungsgabe, hoch talentiert, unangefochten von Zweifeln, Todessehnsucht, Weltschmerz, bietet er zur Zerrissenheit des Fin-de-Siècle den denkbar größten Kontrast. Gutbürgerliche Bildung, alltäglicher Luxus und gelassene Weltoffenheit gehören für ihn zu Selbstverständlichkeiten.
Zweifel am Beschaffensein dieser Welt stellen sich dabei nicht ein. Er liebt es zu leben. Zu diesem Zweck arbeitet, komponiert, dirigiert er. Nicht umgekehrt. Wie Mozart ist Strauss ein Meister des Sinnlichen in der Musik. Und wie dieser bevorzugt er dabei das handgreiflich Lebenssprühende, manchmal das Derbe – im Gegensatz zur Romantik, die ihre Lust aus berührungsloser Sehnsucht zu ziehen sucht. Bei Mozart wie bei Strauss geht’s zur Sache, geht’s um Menschen mit Haut und Haar, um das Körperliche, um die Triebe im Freudschen Sinn. In Strauss’ Tondichtungen und noch mehr in seinem Musiktheater menschelt es gewaltig!
Warum zittert was in mir?
Die „Rosenkavalier“-Figuren animieren viele Sänger-Darsteller und vor allem die Regisseure zur Übertreibung. Das endet oft in öden Klischees. Aber Hofmannsthal und Strauss wünschen sich reale Menschen: eine noble Marschallin, einen stürmischen Octavian, eine reizende Sophie und einen nicht zu drastischen Ochs. Eben nicht bräsig und fett, sondern als „eine Don Juan-Schönheit von etwa fünfunddreißig Jahren…, der sich im Salon der Marschallin soweit anständig benehmen kann, dass sie ihn nicht nach fünf Minuten von ihren Bedienten hinausschmeißen lässt“, so denkt sich Strauss den Schwerenöter. Ein junges Ding will er freien, halb so alt wie er selbst. Aber Sophie, das Girlie, das er sich kraft seines Geldes zuführen lässt, hat anderes im Sinn, sozusagen Gleichaltriges.
Ausgerechnet den Rosenkavalier, der den Antrag des Barons charmant überreichen soll, schwärmt sie an. Der siebzehnjährige Octavian, ein stürmischer „Kerl“ (Strauss besetzt die Rolle nicht mit einem männlichen Sänger, sondern mit einer Mezzosopranistin), schwört der jungen Frau, die er eben erst kennengelernt hat, ewige Liebe.
Noch wenige Stunden zuvor hat er gleiches der Fürstin Werdenberg geflüstert. Die Fürstin von Werdenberg – wegen des Ranges ihres Ehemannes „Feldmarschallin“ genannt – zieht als Schlüsselfigur die Fäden des ganzen Spiels. „Eine junge schöne Frau von höchstens zweiunddreißig Jahren“ (Strauss), nicht eine Matrone von mütterlicher oder gar großmütterlicher Ausstrahlung (wie oft auf der Bühne zu beobachten), neigt sich dem jugendlichen Lover Octavian zu, seitdem ihr Gatte das Ehegemach zugunsten der Wildschweinjagd meidet. Octavian ist jung und sie erfahren genug, das Ablaufdatum seiner Begeisterung zu bedenken. Das klassische ödipale Muster:
Die Marschallin, kinderlos, ist ihm Mutter und Geliebte zugleich. Wer will es ihr verdenken, dass Tränen in ihren Augen schimmern, wenn sie Octavian schließlich ermuntert, einer neuen Liebe zu folgen?
Butterschmalz und Raffinesse
Das von Hofmannsthal übersandte Libretto ließ sich „komponieren wie Öl und Butterschmalz“, begeisterte sich Strauss gegenüber dem Textdichter. Die Dresdner Uraufführung am 26. Januar 1911 wurde bis ins kleinste Detail vorbereitet. Das Publikum nahm die „Umkehr“ des Komponisten zu Melodie und Schönklang erfreut zur Kenntnis. Sehr bald mussten „Rosenkavalier“-Sonderzüge nach Dresden eingerichtet werden. Innerhalb weniger Monate ging das Stück um die Welt – ohne vor barscher Kritik und Entstellungen gefeit zu sein. In Berlin zum Beispiel wurde eine um „anstößige“ Liebesszenen und Wendungen bereinigte Fassung bis 1924 gezeigt.


Zahlreiche Dirigenten wählen von Beginn an ihre Favoriten aus dem „Rosenkavalier“ für Aufführungen außerhalb der Opernhäuser aus.
Heute Abend erklingt jene Suite, die vermutlich der in die USA eingewanderte polnische Dirigent Artur Rodziński, damals Chefdirigent des New York Philharmonic, zusammengestellt
und am 5. Oktober 1944 in New York aus der Taufe gehoben hat. Da 1945 Strauss‘ Verlag Boosey & Hawkes eben diese Suite ohne Hinweis auf einen fremden Bearbeiter veröffentlicht hat, darf angenommen werden, dass diese Auskopplung mit Billigung des Komponisten geschehen ist. Dabei mag ihn – genau wie bei der 1925 von ihm selbst betreuten Anpassung des „Rosenkavaliers“ an den Stummfilm – das liebliche Geräusch klingender Münzen und raschelnder Banknoten besänftigt haben, denn „für mich existiert das Volk erst in dem Moment, wo es Publikum wird. Ob dasselbe aus Chinesen, Oberbayern, Neuseeländern oder Berlinern besteht, ist mir ganz gleichgültig, wenn die Leute nur den vollen Kassenpreis bezahlt haben.“


Die Musik vermag für sich zu sprechen, auch ohne Gesang und Text. Strauss behandelt das Orchester so, dass es nicht nur begleitet, sondern spielt und singt im Sinne der Handlung.
Und wenn die Interpretation Schwung und Tiefe erreicht statt falscher, süßlicher Walzerseligkeit, dann darf man staunen, welche menschlichen Abgründe sich auftun in einer scheinbar so zuckergebackenen Oper wie dem „Rosenkavalier“.
Texte © Steffen Georgi
Kurzbiographien
Andrés Orozco-Estrada

Energie, Eleganz und Esprit – das ist es, was Andrés Orozco-Estrada als Musiker besonders auszeichnet. Von September 2014 bis Juli 2021 war Andrés Orozco-Estrada Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt und verabschiedete sich im Juni 21 mit einem großen Konzert in der Alten Oper, zu dem die Frankfurter Rundschau schrieb: „Das Bild einer Balance aus menschlicher Tadellosigkeit, kommunikationsfähiger Leidenschaft und höchster Professionalität entstand. Ein Orchester, begriff man, will Freude an der Arbeit haben und zugleich musikalisch ernsthaft weiterkommen, und natürlich klingt das leichter, als es ist. Aber gerade die Verbindung aus tänzerisch vergnügter Leichtigkeit und bedingungsloser Perfektionssuche zeichnet die Arbeit des Kolumbianers offensichtlich aus.“ Juni, 2021.
Julia Hagen

Natürlichkeit und Wärme, Vitalität und der Mut zum Risiko: solche Vorzüge werden regelmäßig genannt, wenn von Julia Hagens Spiel die Rede ist. Die junge Cellistin aus Salzburg, Spross einer musikalischen Familie, überzeugt als Solistin mit Orchester ebenso wie im Rezital mit Klavier oder in zahlreichen Kammermusikkonstellationen an der Seite prominenter Partner. Die 27-Jährige, die inzwischen in Wien lebt, verbindet Souveränität im Technischen mit hohem gestalterischen Anspruch und einer unmittelbar kommunikativen Musizierhaltung.
Julia Hagen begann im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel. Der Ausbildung bei Enrico Bronzi in Salzburg sowie bei Reinhard Latzko in Wien folgten 2013 bis 2015 prägende Jahre in der Wiener Klasse von Heinrich Schiff und schließlich ein Studium bei Jens Peter Maintz an der Universität der Künste in Berlin. Als Stipendiatin der Kronberg Academy studierte Hagen darüber hinaus bis 2022 bei Wolfgang Emanuel Schmidt. Sie war Preisträgerin des internationalen Cellowettbewerbs in Liezen und des Mazzacurati Cellowettbewerbs und wurde u.a. mit dem Hajek-Boss-Wagner Kulturpreis sowie dem Nicolas-Firmenich Preis der Verbier-Festival-Academy als beste Nachwuchscellistin ausgezeichnet. 2019 veröffentlichte sie gemeinsam Annika Treutler ihr erstes Album mit den beiden Cellosonaten von Johannes Brahms bei Hänssler Classic. Julia Hagen spielt ein Instrument von Francesco Ruggieri (Cremona, 1684), das ihr privat zur Verfügung gestellt wird.


RSB-Abendbesetzung
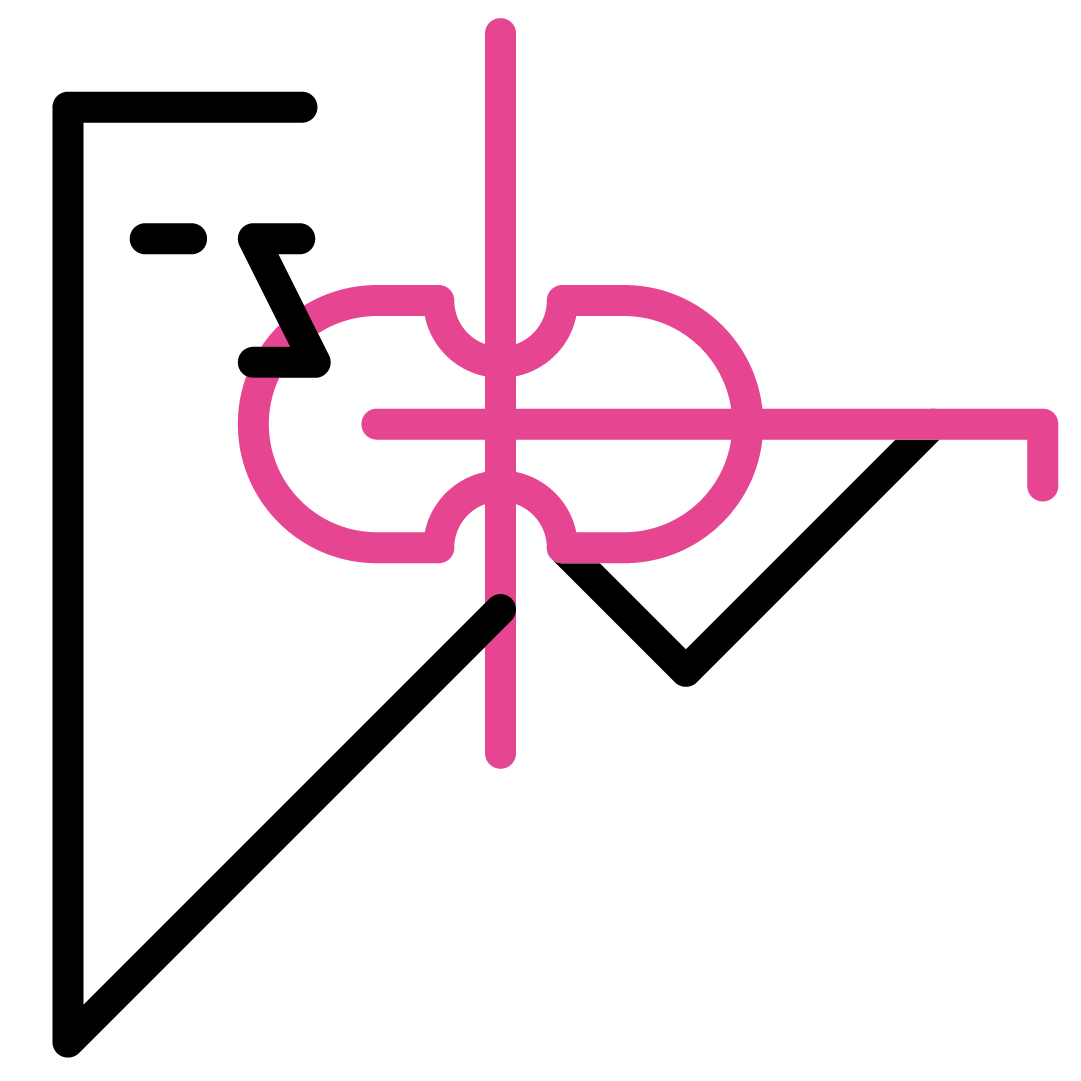
Violine 1
Ofer, Erez
Neufeld, Andreas
Beckert, Philipp
Drechsel, Franziska
Kynast, Karin
Tast, Steffen
Pflüger, Maria
Morgunowa, Anna
Feltz, Anne
Polle, Richard
Yamada, Misa
Behrens, Susanne
Oleseiuk, Oleksandr
Scilla, Giulia
Cazac, Cristin
Marquard, David
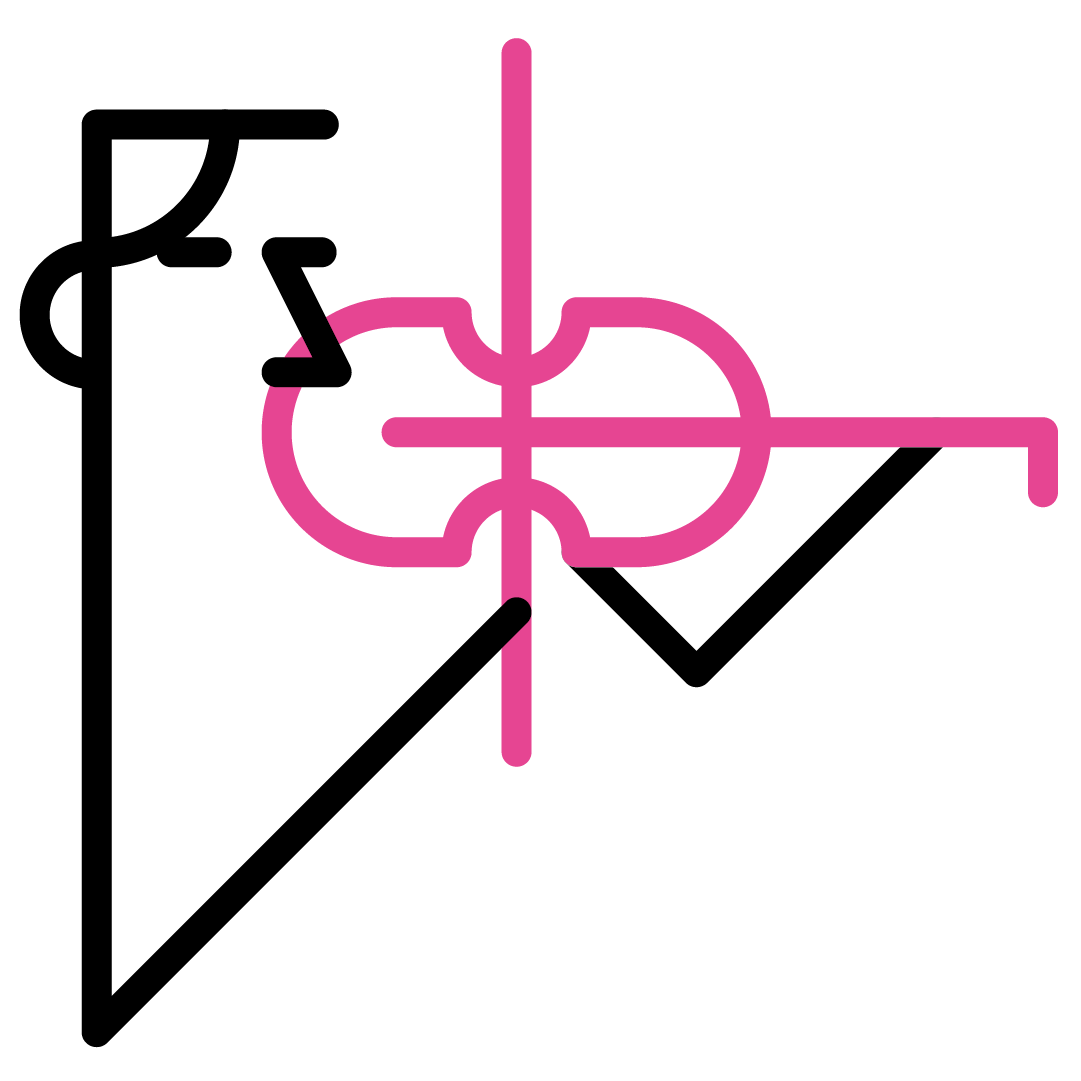
Violine 2
Kurochkin, Oleh
Simon, Maximilian
Drop, David
Seidel, Anne-Kathrin
Draganov, Brigitte
Eßmann, Martin
Manyak, Juliane
Hetzel de Fonseka, Neela
Bara-Rast, Anna
Palascino, Enrico
Färber-Rambo, Juliane
Leung, Jonathan
Guillier, Antoine
Moroz, Georgii

Viola
Rinecker, Lydia
Adrion, Gernot
Silber, Christiane
Zolotova, Elizaveta
Markowski, Emilia
Doubovikov, Alexey
Montes, Carolina
Nell, Lucia
Inoue, Yugo
Yoo, Hyelim
Shin, Hyeri
Roske, Martha
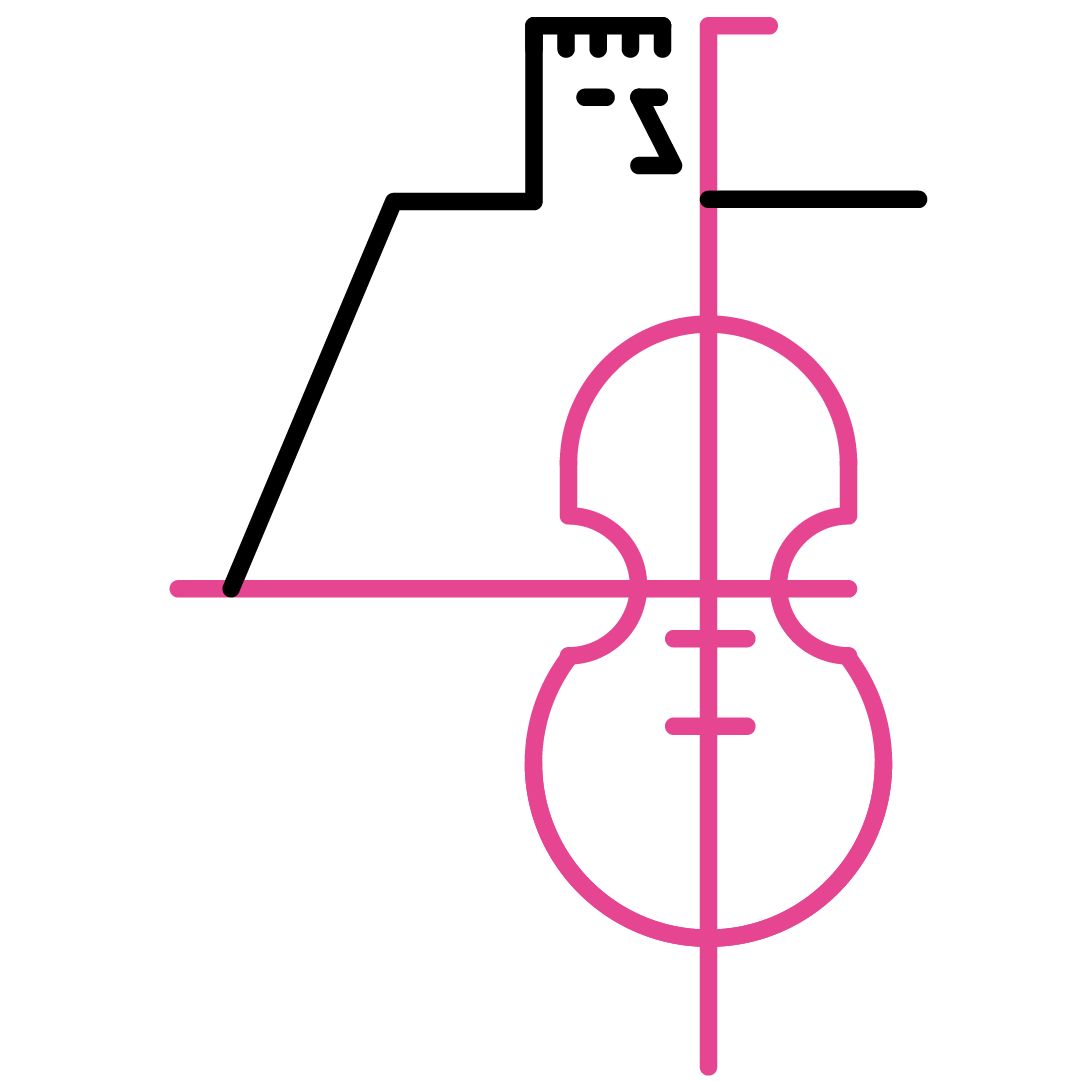
Violoncello
Eschenburg, Hans-Jakob
Riemke, Ringela
Breuninger, Jörg
Weiche, Volkmar
Albrecht, Peter
Boge, Georg
Weigle, Andreas
Bard, Christian
Kipp, Andreas
Kim, Jean
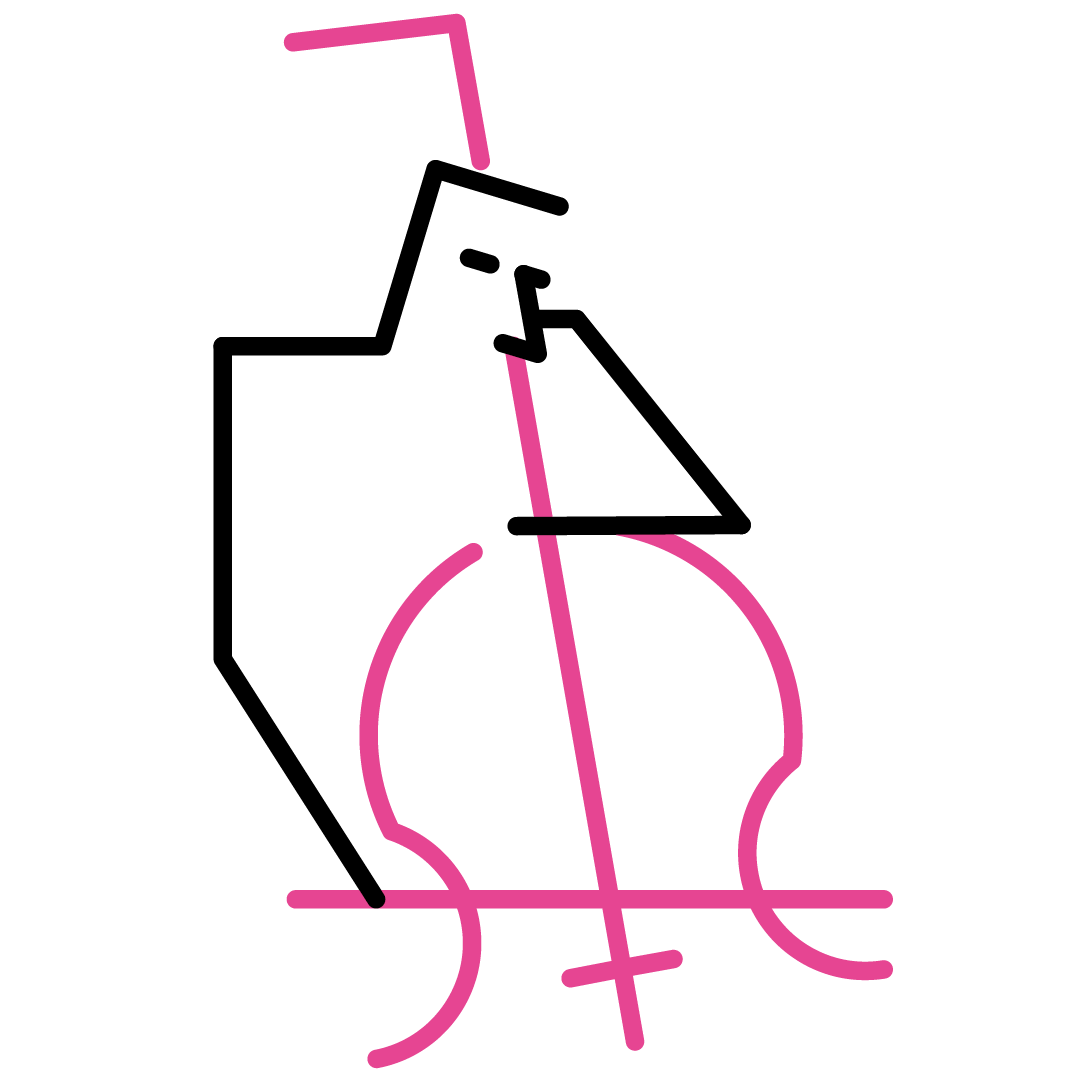
Kontrabass
Wagner, Marvin
Rau, Stefanie
Schwärsky, Georg
Buschmann, Axel
Ahrens, Iris
Gazale, Nhassim
Thüer, Milan
Moon, Junha
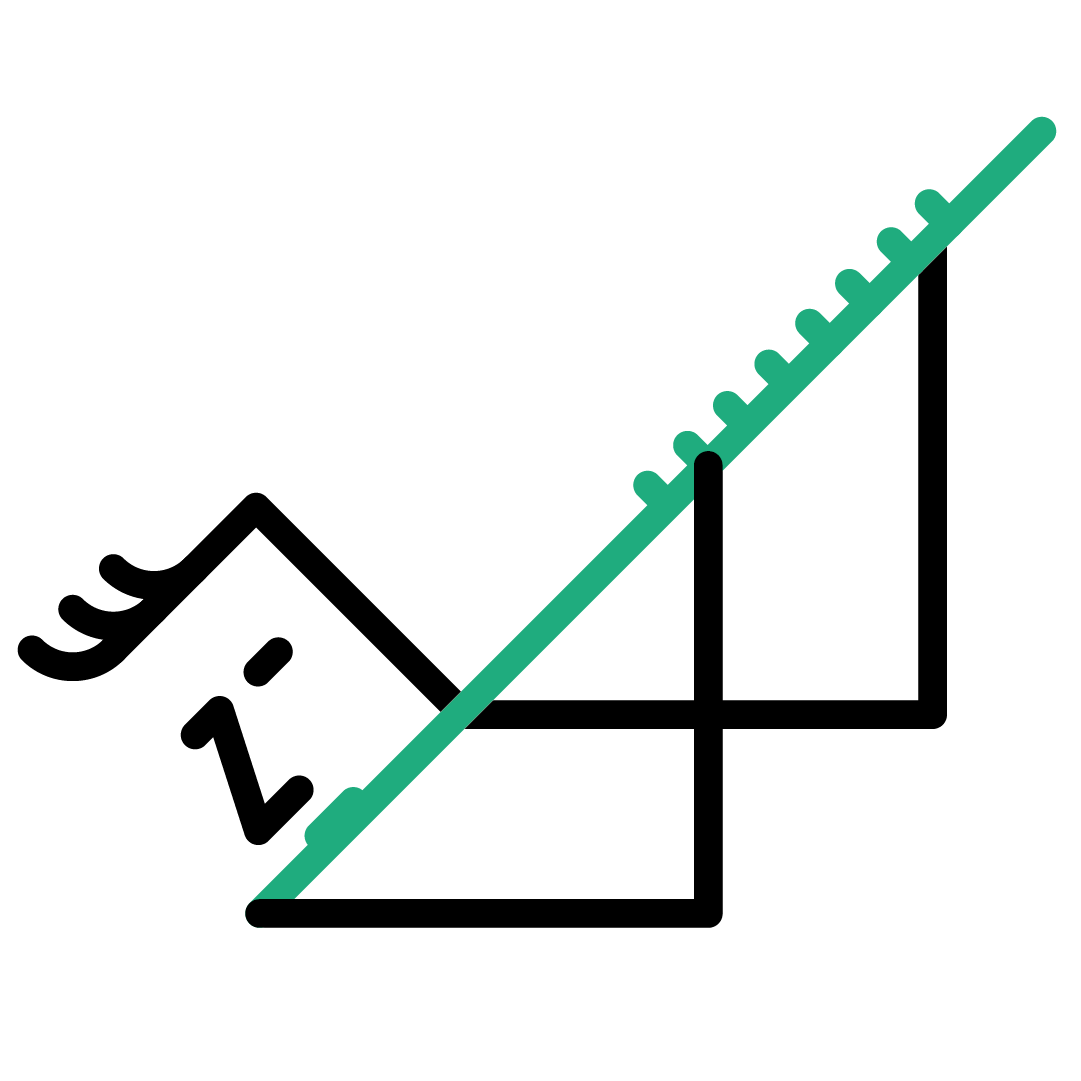
Flöte
Schaaff, Ulf-Dieter
Döbler, Rudolf
Hasl, Michael
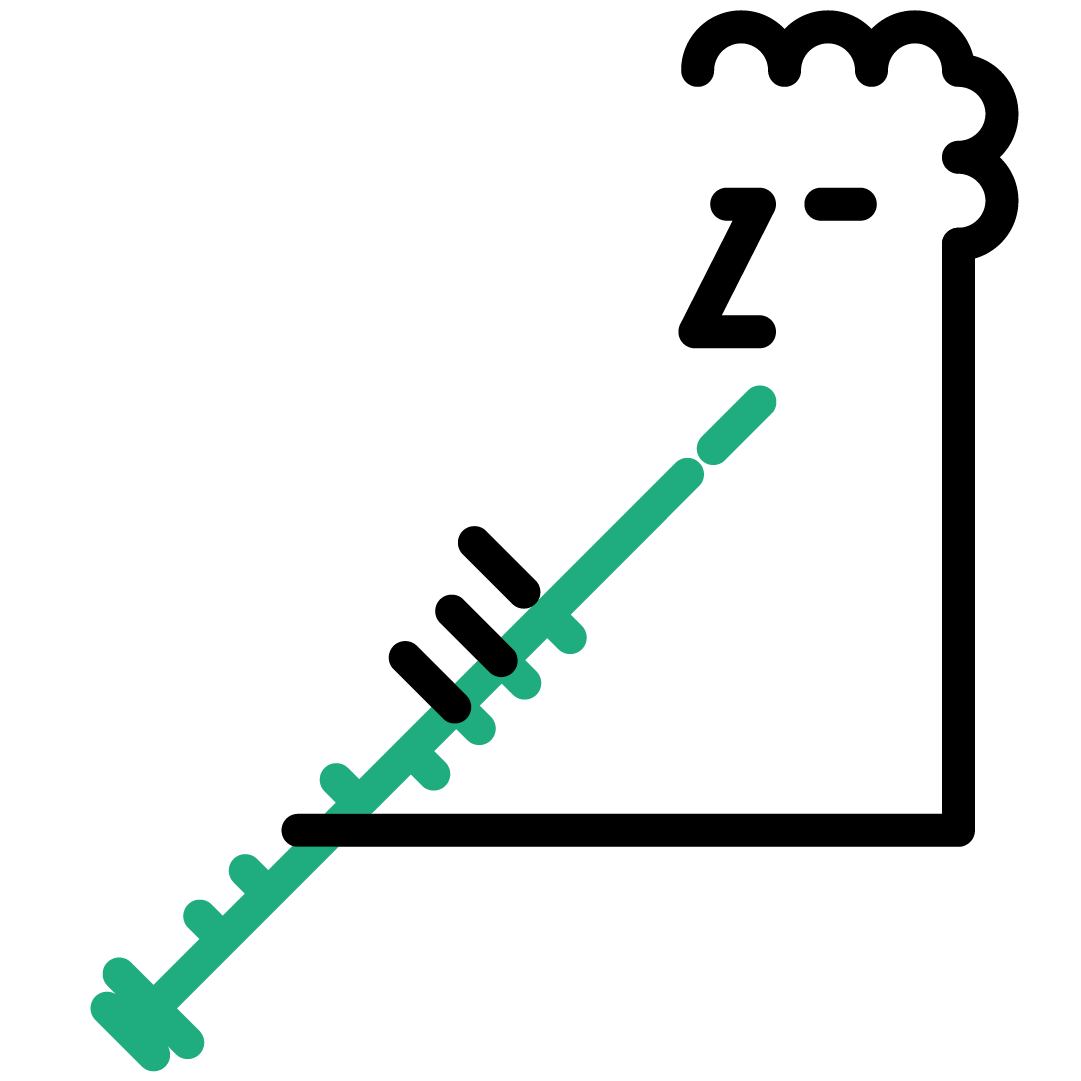
Oboe
Bastian, Gabriele
Grube, Florian
Vogler, Gudrun
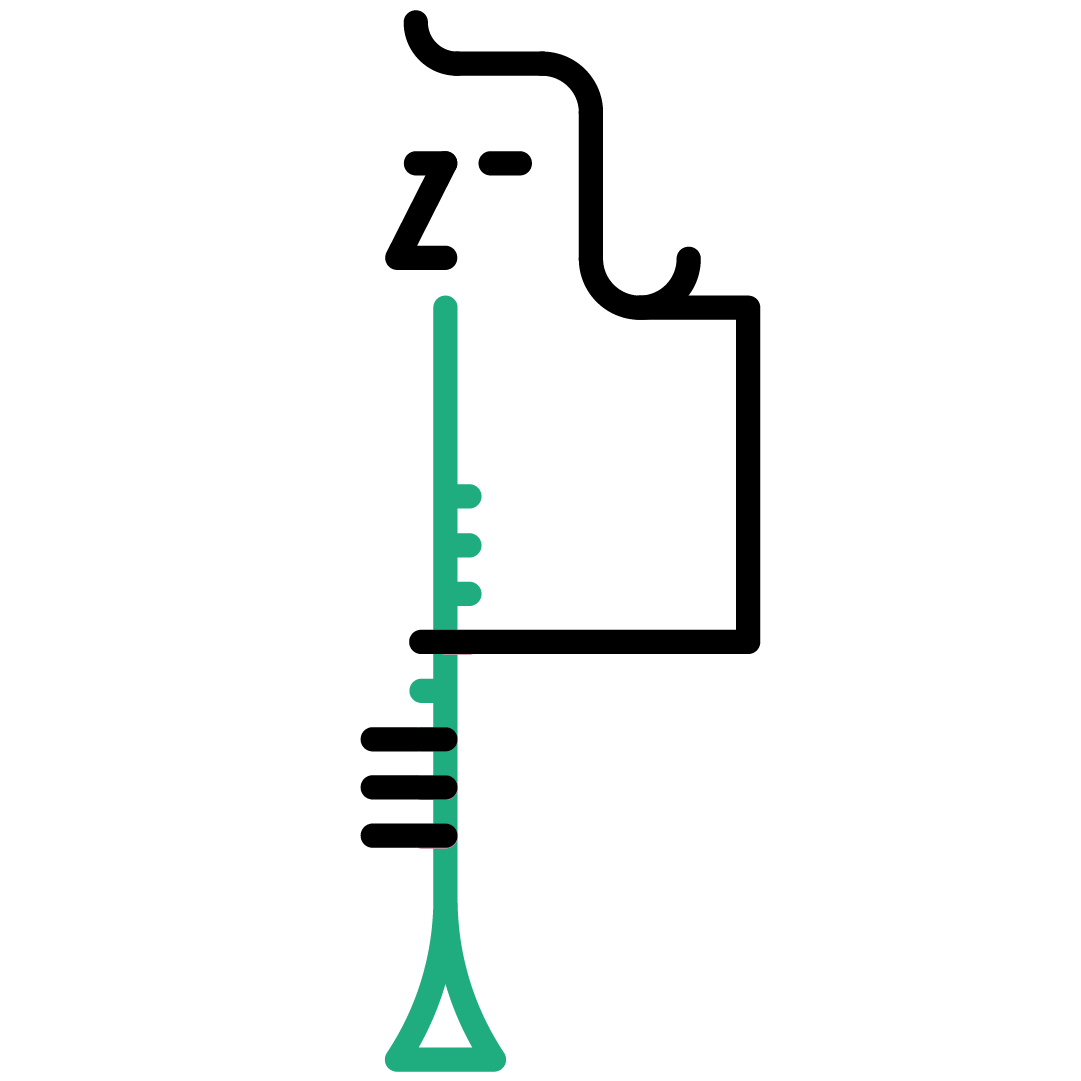
Klarinette
Kern, Michael
Rodriguez Herrero, Hugo
Pfeifer, Peter
Korn, Christoph
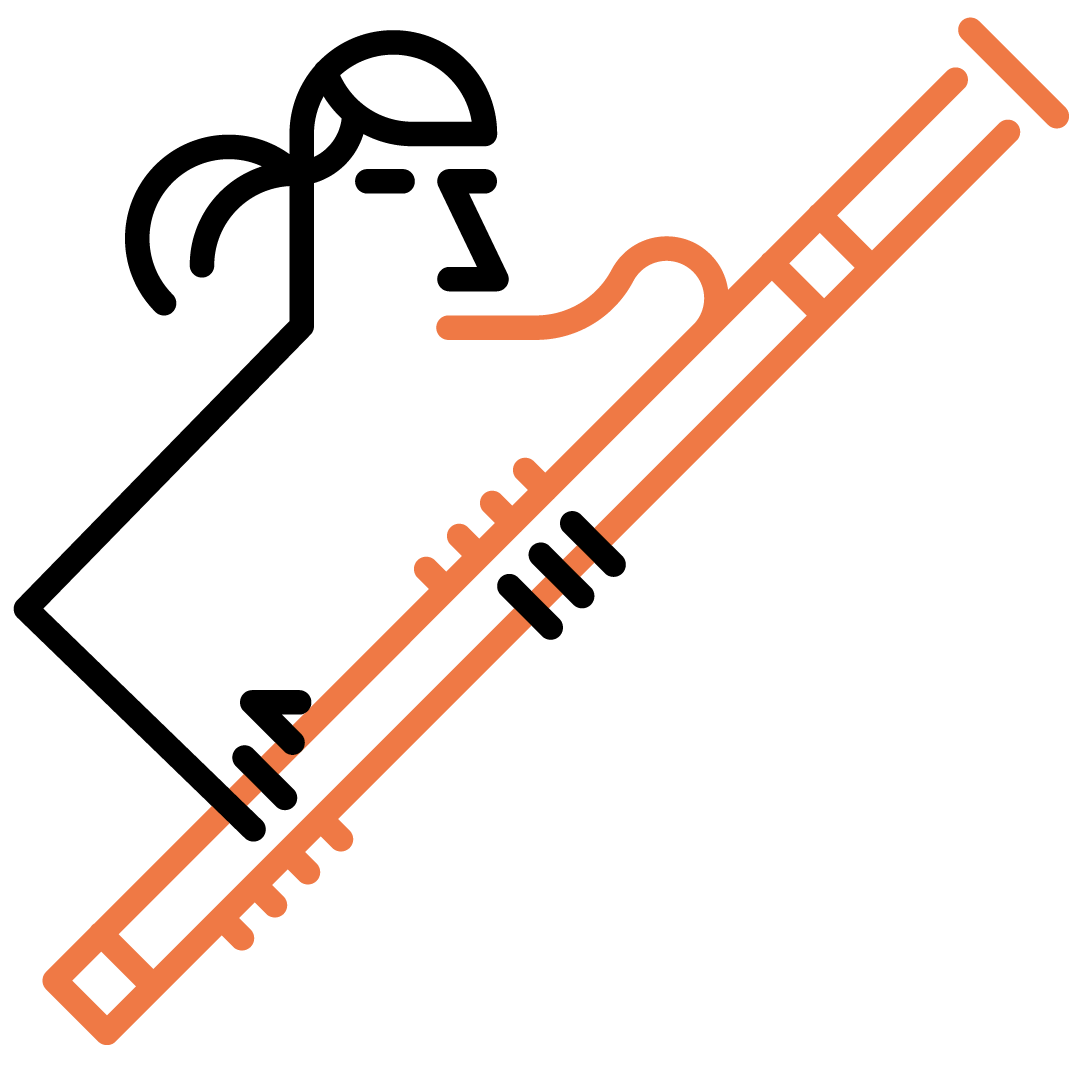
Fagott
Kofler, Miriam
Adrion, Sebastian
Königstedt, Clemens

Horn
Ember, Daniel
Holjewilken, Uwe
Mentzen, Anne
Hetzel de Fonseka, Felix

Trompete
Dörpholz, Florian
Niemand, Jörg
Gruppe, Simone

Posaune
Manyak, Edgar
Vörös, József
Lehmann, Jörg

Tuba
Rodehorst, Elias

Harfe
Edenwald, Maud
Ravot, Marion

Schlagzeug
Tackmann, Frank
Thiersch, Konstantin
Grahl, Christoph
Azers, Juris
Vehling, Hanno
Lindner, Christoph
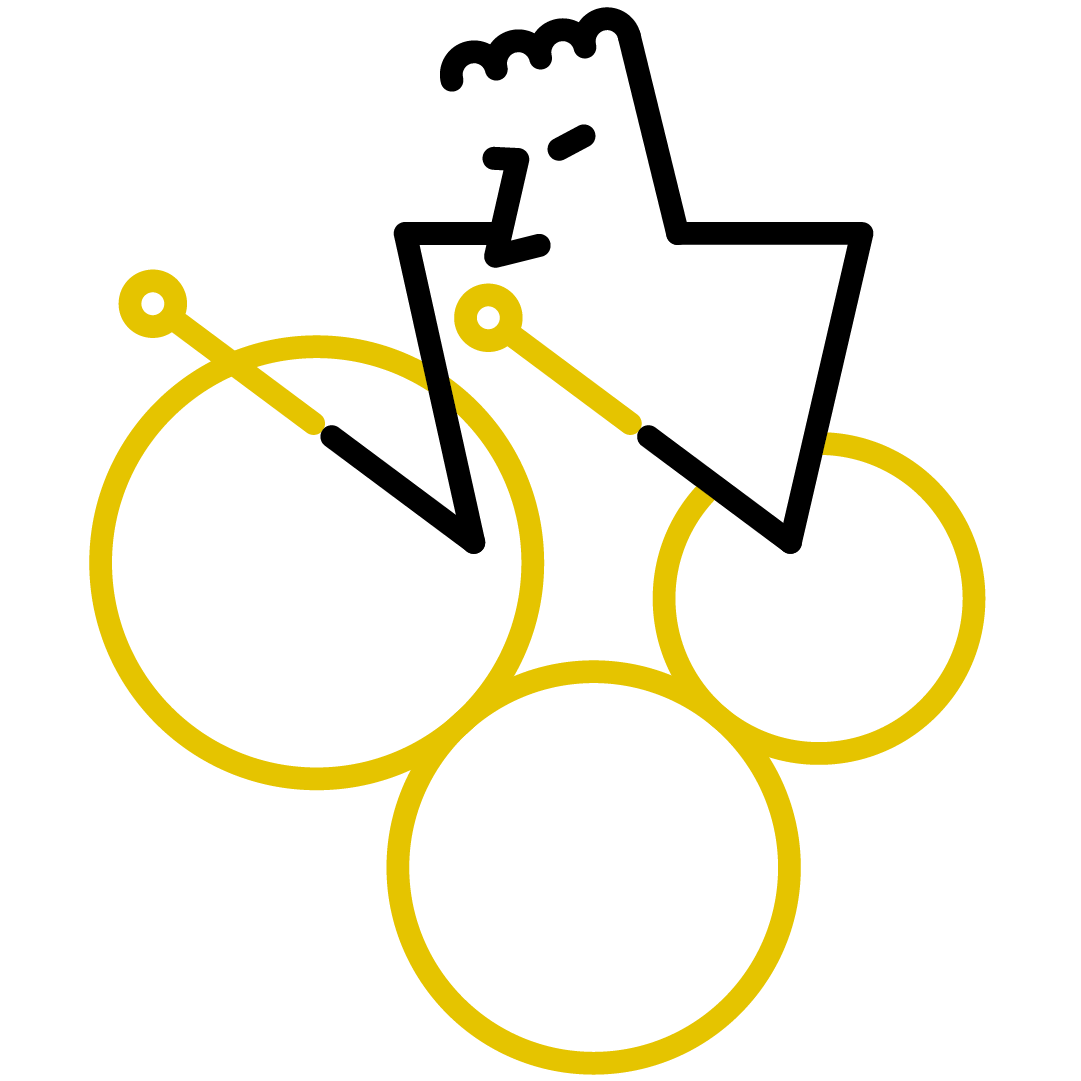
Pauke
Eschenburg, Jakob
Celesta
Inagawa, Yuki

Kooperation


Bildrechte
Portraits Andrés Orozco-Estrada © Werner Kmetitsch
Julia Hagen und Andrés Orozco-Estrada bei der Probe © Peter Meisel
Bilder Orchester © Peter Meisel